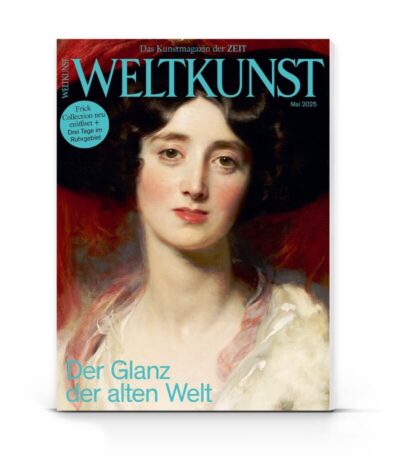Gastspiel aus traurigem Anlass
Meisterwerke aus dem Odesa Museum für Westliche und Östliche Kunst finden temporär in der Berliner Gemäldegalerie Zuflucht
Von
22.04.2025
/
Erschienen in
Weltkunst Nr. 240
Vor anderthalb Jahren machte sich eine besondere Fracht auf den Weg: 74 Gemälde des Odesa Museums für Westliche und Östliche Kunst reisten aus einem Lager, in dem sie seit Beginn des Krieges in der Ukraine verstaut waren, nach Berlin – Werke aus vier Jahrhunderten, größtenteils ungerahmt. Sechzig davon sind nun in einer Ausstellung in der Gemäldegalerie zu sehen, ergänzt durch einige Arbeiten aus hiesigen Beständen. Die Schau „Von Odesa nach Berlin“ angesichts der dramatischen Umstände ihrer Entstehung einen Glücksfall zu nennen, erscheint unpassend. Und doch ist sie ein Glück – eines, das in der Betrachtung von Kunst liegt, die den meisten hierzulande unbekannt ist.
Denn wer könnte von sich sagen, ein Bild wie Jules-Alexis Mueniers „Streit der Kutscher“ von 1893 zu kennen? Im gleißenden Licht des Südens liegt ein Mann am Boden, während der andere vor ihm steht und schon bereit ist für den nächsten Schlag. Die ziemlich schockierende Szene spielt auf einer Küstenstraße am Mittelmeer, aber man denkt an Kain und seinen Bruder Abel. Oder an die aktuelle politische Lage.
Es schwingt Melancholie mit, wenn man vor diese Werke tritt. Sie sind in Sicherheit – was man von den jungen Menschen, die in diesem Krieg kämpfen müssen, nicht behaupten kann. So liegt ein Schatten über der ausgesprochen geschmackvollen Präsentation in der Mittelhalle der Gemäldegalerie. Es ist der Schatten der Realität. Kunst als Erbauung? Als Alltagsflucht? Wohl kaum.
Da ist die Gräfin Olena Tolstoi, die Domenico Morelli 1875 porträtierte. Der Künstler aus Neapel war als Vertreter des Naturalismus damals gefragt. Heute ist sein Ruhm verblasst, aber die Gräfin mit ihrem schwarzen Kleid, den schwarzen Haaren und dem weißen Umhang malte er mit solch ergreifendem Ernst, dass man glaubt, sie ahnte, was ihr Bildnis 150 Jahre später erwarten würde.

Etwa ein Drittel der ausgestellten Gemälde stammen aus dem 19. Jahrhundert, doch es sind auch Werke aus der Renaissance, dem Barock und dem Rokoko darunter, zum Beispiel überaus detailreiche und farbensatte Stillleben von Jan Davidsz de Heem aus Antwerpen und seinem Sohn Cornelis de Heem. Oder die rätselhaften, vielfigurigen Bilder von Alessandro Magnasco aus Genua mit Titeln wie „Rasur der Mönche“ und „Erholung der Komödianten“ aus der Zeit um 1730.
Von Frans Hals besitzt das Odesa Museum zwei qualitätvolle Darstellungen der Evangelisten Lukas und Matthäus, um 1625, von Abraham Bloemaert aus Amsterdam das Bildnis einer alten Frau und sein eindrückliches Gegenstück, das „Brustbild eines alten Mannes“, ebenfalls um 1630. Die beiden Letzteren werden komplettiert durch die der Gemäldegalerie gehörende „Alte Frau mit Pelzmütze“ von Gerrit Dou. Doch die echten Entdeckungen stammen aus dem 19. Jahrhundert: die stimmungsvollen Abendbilder des skandinavischen Kosmopoliten Frits Thaulow oder die frühsymbolistische Blinde im weißen Kleid von Gabriel von Max. Das Gemälde heißt „Licht“ – es ist eine Empfehlung, nein eine Aufforderung, die sich an die Gegenwart richtet.