
„Es gibt keine Worte mehr für diese Werke“
Die Kunsthistorikerin Yaëlle Biro erprobt im New Yorker Metropolitan Museum, wie sich die klassische Kunst aus Afrika im globalen Norden ausstellen lässt. Ein Gespräch über die sogenannten Völkerschauen, den Weg von der Ethnologie zum Kunstmarkt und die Suche nach einer Sprache
Von
07.05.2021
/
Erschienen in
WELTKUNST Nr. 165
Die Kunsthistorikerin Yaëlle Biro, Französin mit einer deutschen Mutter, ist Afrika-Kustodin am Metropolitan Museum of Art in New York. In ihrem preisgekrönten, 2018 in Frankreich erschienenen Buch „Fabriquer le regard“ zeigt sie, wie Europäer und Amerikaner vor und nach 1900 den Blick auf afrikanische Artefakte konstruierten. Präzise verfolgt Biro die Wandlung der zunächst ethnologischen Stücke zu Kunstwerken. Ausgelöst wurde diese Entwicklung nicht unerheblich im deutschen Kaiserreich: 1873 verordnete man in Berlin per Dekret den Bau des nach München zweiten Völkerkundemuseums. Vor dem kolonial-imperialen Hintergrund entstanden rasch weitere Häuser in Hamburg, Dresden oder Leipzig. Allein in Berlin verachtfachte sich zwischen 1884 und 1914 die Zahl der afrikanischen Objekte.

Eine entscheidende Rolle spielte der Kunstmarkt. Händler auf beiden Seiten des Atlantiks stachelten das Sammelfieber an. Gezielt platzierten sie Werke in Ausstellungen und Publikationen und kreierten einen Kanon der afrikanischen Kunst. Erst auf dieser von kommerzieller Dynamik bestimmten Matrix bewertete, wie Biro darlegt, eine kleine Gruppe von Künstlern und Kritikern um Guillaume Apollinaire die bereits ausgewählten und ästhetisierten Objekte neu. Ein ebenso kreatives wie aktives Netzwerk aus Händlern, Sammlern und Protagonisten der Avantgarde stellte klassische afrikanische und moderne europäische Kunst zusammen aus. So verankerten sich beide Kulturkomplexe fest im Fokus der Moderne. Indem Biro diesen Prozess Schritt für Schritt nachvollzieht, dabei Sammlungsgeschichten, Marktereignisse, Geschmacksbildung und die Entwicklung des Kolonialismus kreuzt, legt sie das Fundament für einen neuen Blick auf die Kunst aus Afrika. Im Interview erläutert Yaëlle Biro ihre Forschungen und die Herausforderung, klassische afrikanische Kunst heute angemessen auszustellen.

Frau Biro, man könnte den Titel Ihres Buches mit „Den Blick erzeugen“ übersetzen. Zugleich verweist das Wort fabrique auch auf textile Gewebe. Wie kann ein Blick „fabriziert“ werden?
Ein Blick entsteht, indem man Objekte, Bilder, Personen sieht, ihnen gegenübersteht. Im speziellen Fall afrikanischer Objekte mussten sie Anfang des 20. Jahrhunderts zugänglich sein, sie mussten gezeigt werden. Dafür wirkten Akteure zusammen, nahmen neue Gewichtungen vor, richteten den Blick neu aus. Vor allem rückten sie die Objekte anders ins Blickfeld, machten sie quasi erst sichtbar. Vorher als Zeugnisse einer fremden, unzivilisierten Welt wahrgenommen, wurden die Kuriosa mit der Ankunft in Künstlerateliers, bei Kunsthändlern und Sammlern Kunstprodukte. Die Forschung hat sich bisher auf den Einsatz der Künstler ab den 1910er-Jahren konzentriert. Ich wollte einen breiteren Kontext aufzeigen, wollte hinterfragen, wodurch diese Transformation der Objekte möglich wurde.
Sie stellen in dem Buch, wie 2013 auch in Ihrer Ausstellung „African Art, New York, and the Avant-Garde“, die prägende Rolle der zeitgleich sich als modernes Leitmedium etablierenden Fotografie heraus. Wieso?
Um zur Fabrikation des Blicks beizutragen, mussten die Objekte Teil eines mitteilbaren Imaginären werden. Wie ich es etwa beim amerikanischen Maler und Fotografen Charles Sheeler zeigen konnte, wurde das afrikanische Objekt vor dem Objektiv seiner Kamera vereinzelt. Die spezielle Ausleuchtung und räumliche Inszenierung machte es erst eigentlich zum Kunstwerk. Händler wie Joseph Brummer in Paris ab 1911 oder Marius de Zayas in New York ab 1915 nutzten systematisch das junge Medium und platzierten die Abbildungen gezielt in der Presse und in Katalogen. Vergleichen Sie Aufnahmen „ethnologischer Objekte“ vor 1900 mit „afrikanischer Kunst“: vorher nur ein Haufen Dinge, jetzt ein charakteristisches Objekt. Die Fotografie, selbst ein Medium der Auswahl, hat die Objekte individualisiert. Wie ein Porträt wurden sie zum Gegenüber, in dem sich die Identität der Moderne erkennen konnte.
Die afrikanische Kunst hat eine lange Begriffsgeschichte hinter sich: von „exotischer Kunst“ (Guillaume Apollinaire, 1912) oder „Negerplastik“ (Carl Einstein, 1915) über „Künste Afrikas“ (Umbenennung des Musée des colonies in Paris, 1960) und „erste Kunst“ (Ausstellung „Art premier en Afrique“ in Arras, 1981) bis zu „klassische und Stammes-Antike“ (Musée Barbier-Mueller in Genf, 2019), um nur einige Beispiele zu nennen. Das zeugt von andauerndem Unbehagen und Identitätswandel. Wie sollen wir heute diese Objekte nennen?
Die Geschichte der Terminologie ist vielleicht ohne Ende. Es gibt so viele falsche Kategorien – man müsste fast eine neue Sprache erfinden. Wir sind heute an einem Punkt, wo es keine Worte mehr für diese Werke gibt. Sie sind nicht unter einem Begriff zusammenzufassen. Ich habe da keine Lösung, spreche selbst von „arts de l’Afrique“ (Künste Afrikas), weil der Plural zumindest Vielfalt, Komplexität anzeigt. Die allgemeinen Benennungen, die seit dem 20. Jahrhundert benutzt werden, entfernen die afrikanischen Objekte. Sie bringen sie in geografische oder zeitliche Distanz. Eine Ferne, die sich von einem abendländischen Blickpunkt aus ergibt. Keiner der verwendeten Begriffe charakterisiert die Objekte selbst, vielmehr werden sie dem abendländischen Paradigma unterworfen. Moderne und klassische Kunst abzugrenzen, Stile festzulegen und sie an Kulturgruppen zu binden leugnet die unabhängige Dynamik der Herkunftskulturen. Wir müssen uns der Komplexität und den historischen Kontexten zuwenden, in denen diese Namen entstanden.

In Ihrer Studie zeigen Sie die Rolle deutscher Händler für die Marktentwicklung Anfang des 20. Jahrhunderts.
Ich wollte das dynamische Händlernetzwerk von damals beleuchten. Es war europäisch, nicht nur deutsch. Auch wenn ich die Bedeutung speziell des Hamburger Familienunternehmens J. F. G. Umlauff für die Zulieferung ethnologischer Objekte erörtere: Das Sammelfieber ist ein europäisches, später amerikanisches Phänomen. Natürlich haben Künstler und Intellektuelle wie Carl Einstein dabei eine wesentliche Rolle gespielt, das Bewusstsein mitentwickelt, unter dem der Blick neu formatiert wurde. Doch das reicht nicht, um zu erklären, wie es zu einer so rasanten Entwicklung vom ethnologischen Objekt zum Kunstwerk kommen konnte. Das geschah ungefähr von 1905 bis 1914, in weniger als zehn Jahren! Dafür brauchte es andere Kräfte; Netzwerke und Ereignisse wirkten zusammen. Nehmen Sie zum Beispiel die familiäre Verbindung von Caroline Umlauff und ihrem Bruder Carl Hagenbeck. Dessen Erfahrungen mit seinen Völkerschauen und dem Zoo bei Hamburg haben sicher dazu beigetragen, dass man zu Verkaufszwecken die afrikanischen Objekte in Dioramen oder auf Puppen in Szene setzte. Diese damals sehr beliebten, heute kritisch betrachteten Inszenierungen trugen zu einer Theatralisierung des Anderen bei. Doch erst die Darbietung durch Händler und Sammler verwandelte die von Umlauff verkauften Objekte in Kunst. Was übrigens keinesfalls historische Verbindungen zu ihren Urhebern und Kulturen erhellte. Vielmehr waren die „neuen“ afrikanischen Objekte anonyme Kunst-Individuen, ideale Projektionsflächen.
Man könnte sagen, die afrikanische war für die moderne Kunst des 20. Jahrhunderts, was die griechische für die klassische Kunst des 18. Jahrhunderts war. Spielen diese Mechanismen noch immer eine Rolle?
Sicher, die Mechanismen des Kunstmarkts, die mit Fotografie Wertigkeit suggerieren, mit spezifischem Vokabular Definitionsmacht beanspruchen, mit ästhetischen Urteilen Auswahl treffen und so einen Marktwert setzen und dann weiter steigern, haben sich seit Anfang des 20. Jahrhunderts kaum verändert. Es ist ein Erfolgsmodell, dessen Funktionsweisen historisch aufgearbeitet werden. Wir haben heute die enorme Chance, unseren Blick auf die Geschichte zu verändern. Etwa die 1913 aufkommende systematische Parallelführung von Picassos Kubismus mit den Künsten Afrikas: Es ist fast so, als würden die afrikanischen Werke erst Picassos Kunst sichtbar machen.

Ausstellungen waren entscheidend für diese Entwicklung. Sie waren der Ort, an dem sich das „Subjekt der Moderne“ konstruierte. Wie kann, wie sollte man heute klassische afrikanische Kunst ausstellen?
Es gibt keine einzig gültige Art, diese Objekte – und Kunst ganz allgemein – zu zeigen. Jede Institution, jede Sammlung hat ihre eigene Geschichte und Aufgabe. Diese Eigenheiten müssen wir berücksichtigen und diskutieren, ebenso wie die Kontexte.
Das würde bedeuten, dass Ausstellungen immer ihre eigenen Bedingungen thematisieren sollten. Wie setzen Sie das in Ihrer Abteilung im Metropolitan Museum um?
Mich interessiert natürlich die Geschichte des 1870 gegründeten Museums, das immerhin 5000 Jahre Kulturgeschichte umspannt. Die Afrika-Sammlung formierte sich seit den Vierzigern, also direkt nach der Zeit, die ich in meinem Buch behandle. Unsere Abteilung entstand aus der Sammlung von Nelson Rockefeller, die er ab 1940 bereits unter einem anderen Paradigma aufgebaut hatte. Ihm ging es um die „besten“ Werke, sein Blick und sein Geschmack waren von den Anfang des 20. Jahrhunderts als „große Klassiker“ Afrikas definierten Objekten geprägt. Zudem kaufte er in einem gefestigten Kunstmarkt, griff nach dem, was bereits als „Ikone“ gesichert war. 1969 kam die Sammlung als Schenkung ans Met, dadurch konnte das Museum den Kanon für historische Kunst aus afrikanischen Ländern weiter festigen.
Wenn der moderne westliche Blick aus der Beziehung zu diesen Objekten und deren Wandlungen gewebt wurde, müsste man ihn heute sozusagen aufdröseln?
Aufdröseln geht wohl nicht, der Blick ist fest mit der Retina verwachsen. Ich denke, es geht heute eher um eine gewisse Klarsicht. Wir müssen sichtbar machen, was unseren Blick bestimmt hat. Vor allem geht es um eine historische Sicht. Die ahistorische, rein ästhetische Betrachtung der Künste Afrikas sollte überwunden werden. Es wäre aber kurzsichtig, die Objekte historischer Künste Afrikas allein unter dem Prisma des Kolonialismus wahrzunehmen. Sie haben eine tiefere, reichere und komplexere Geschichte. Und diese wird heute erzählt: Viele Wissenschaftler und Intellektuelle auf dem Kontinent, in Europa und den USA fragen nach der agency, also danach, wer Handlungen bestimmt und ausrichtet und wer sie erleidet. Mir ist klar, dass die Perspektive in meinem Buch eine abendländische bleibt. Ein blinder Fleck meiner eigenen Forschung ist etwa die Auswahl der Objekte vor Ort. Ich würde jetzt gern erfahren, wer auf dem Kontinent dafür gesorgt hat, dass bestimmte Objekte auf die Handelswege gerieten. Wieso diese? Was wurde nicht gehandelt? Antworten darauf könnten unser Verständnis der Entstehung des Kanons der Künste Afrikas und unseren Blick auf die Kunst des 20. Jahrhunderts grundlegend verändern.
Wichtige Akteure sind heute die Künstler in Afrika und der Diaspora. Braucht es afrikanische Gegenwartskunst, um die historischen Objekte neu zu bewerten?
Die zeitgenössischen Künstler geben wichtige Impulse, sorgen für ein neues Interesse und für neue Fragestellungen. Ich denke aber, es wäre ein Irrtum, zeitgenössischer Kunst die „Rettung“ der historischen aufzuladen. Das verfehlt deren Bedeutung. Man kann nicht alle unbequemen Fragen den Künstlern überlassen. Es ist auch eine wichtige Rolle der Museen, politisch ebenso wie wissenschaftlich schwierige Fragen zu stellen. Ich beobachte mit viel Interesse die Arbeit zeitgenössischer Künstler zu diesem Thema und finde sie sehr wichtig, weil sie gerade die Relevanz der historischen Künste Afrikas heute deutlich machen. Aber ich denke auch, dass die Objekte selbst die Kraft haben, viel und für sich selbst zu erzählen.
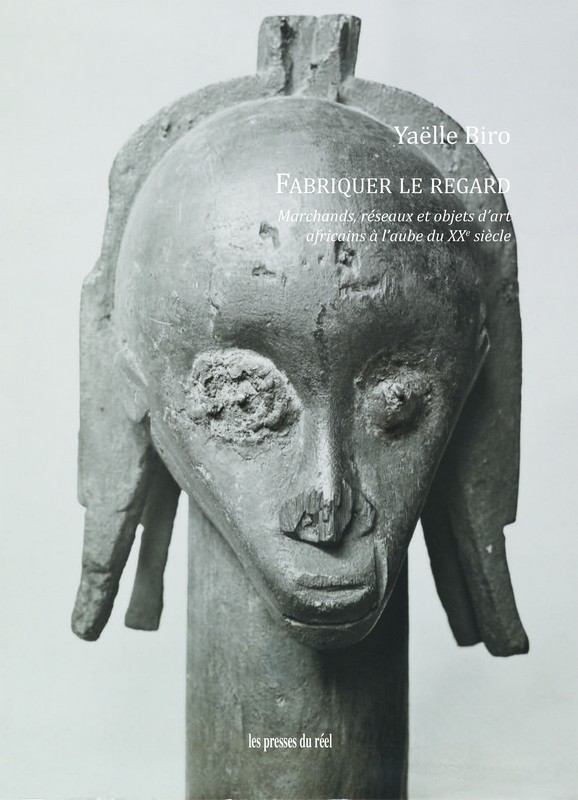
Service
BUCH
„Fabriquer le regard – Marchands, réseaux et objets d’art africains à l’aube du XXe siècle“
von Yaëlle Biro,
Frankreich, 2018.
Online bestellen bei les presses du réel






