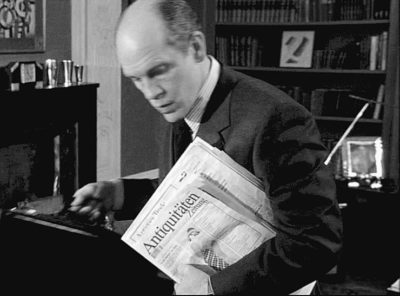Diese interessante Nüchternheit
Trotz des Booms der Neuen Sachlichkeit ist die Preisentwicklung des Berliner Malers Gustav Wunderwald stark rückläufig. Wie kommt das?
Von
07.11.2022
Als den „Berliner Utrillo“ feierte der Kritiker Paul Westheim den neusachlichen Architektur- und Landschaftsmaler Gustav Wunderwald (Kalk 1882 – 1945 Berlin) in einer Ausstellungsrezension, und angeblich nahm der Angesprochene das Etikett durchaus als Kompliment. Aber im Grunde war vermutlich beiden klar, dass der spontane Vergleich mit dem fast gleichaltrigen Franzosen wesentliche Unterschiede im Ansatz beider Künstler geflissentlich unter den Tisch fallen ließ. Maurice Utrillos lichte, vitale Palette blieb Wunderwald fremd, der gerade bei seinen Berliner Ansichten meist an einem von bräunlich-grauen Tonwerten bestimmten Farbschema festhielt. Und auch das Lebensgefühl auf Utrillos Montmartre war denkbar weit entfernt von den Fabrikanlagen oder den kaum wohnlicheren Quartieren in den Berliner Arbeitervierteln Wedding, Moabit oder dem Prenzlauer Berg, wo der Deutsche überwiegend seine Motive suchte.
Gerade dieser sozialkritische Aspekt seiner Architekturbilder fehlt bei seinem angeblichen Pariser Pendant völlig. Utrillo hatte sich überwiegend auf reine Ansichten konzentriert, die etwa bei einem touristischen Rundgang auf seinen Spuren zum Teil heute noch wiederzufinden wären. Wunderwald hingegen zeigte sich am möglichen historischen Wert seiner Architekturbilder kaum interessiert. Die vorgefundene Bausubstanz stellte für ihn oft nur einen Ausgangspunkt dar, um die funktionale Kälte der Straßenzüge, Plätze und Reklamewände nachdrücklich ins Expressive zu steigern. Zugleich ging er damit auch der unausgesprochenen Frage nach, was es für die Bewohner bedeuten mochte, in einem derart inhumanen Environment ihr Leben zu fristen – auch wenn diese im Bild nur selten und allenfalls als anonyme, verschwindend kleine Rückfiguren zugegen sind. Er selbst kommentierte 1926 seine Faszination für die Schattenseiten urbaner Gesellschaften so: „Die tristesten Dinge haben es mir angetan und liegen mir im Magen, Moabit und der Wedding packen mich am meisten, diese interessante Nüchternheit und Trostlosigkeit“.

Vor dem Beginn seiner eigentlichen Karriere als Maler ging Gustav Wunderwald mit Erfolg einem anderen Beruf nach: Nach einer zweijährigen Lehrzeit bei dem Kölner Malermeister Wilhelm Kuhn arbeitete er zunächst als Kulissenmaler in Gotha und wechselte danach in das Charlottenburger Atelier für Theatermalerei. Nach einer mehrjährigen Tätigkeit als Bühnenbildner an der Königlichen Oper in Stockholm ging er zurück ins Rheinland, wo seine viel beachtete Arbeit im Schauspiel- und Musikvorstand des Düsseldorfer Schauspielhauses zu einer ersten Ausstellung führte. Nach weiteren Stationen in Innsbruck und Freiburg erhielt er eine Anstellung als Dekorationsmaler am Deutschen Opernhaus in Berlin-Charlottenburg, bevor er 1915 für den Kriegsdienst in Mazedonien eingezogen wurde. Nach Kriegsende lebte er als freier Maler in Berlin. Bis dahin hatten im Wesentlichen Landschaftsthemen sein Repertoire bestimmt, die neben seiner Theater-Arbeit entstanden waren: überwiegend realistische Naturaufnahmen aus dem Rheinland, der Umgebung Berlins, Tirol, dem Schwarzwald und von seinem Fronteinsatz in Mazedonien, daneben auch Bildnisse von seiner Frau und anderen Familienangehörigen wie auch von einigen Kriegskameraden.
Als Höhepunkt seiner Tätigkeit als Maler gelten allerdings unverändert die erst seit Mitte der Zwanzigerjahre entstandenen Berliner Architekturmotive, neben den erwähnten Arbeiterquartieren auch Ansichten von Zweckbauten wie Bahnhöfen, Industriegebäuden und Brücken, auch wenn daneben weiterhin landschaftliche und dörfliche Impressionen aus dem Umland Berlins sowie aus Ostpreußen entstanden. Es war schließlich Wunderwalds Beteiligung an der Gruppenausstellung „Das Gesicht von Berlin 1926“ in der Berliner Galerie Neumann & Nierendorf, die Westheim zu seinem etwas hinkenden Vergleich mit Utrillo anregte. Mit seiner Teilnahme an der „Großen Berliner Kunstausstellung“ kam für den Maler das berufliche Aus: Er wurde von den Nationalsozialisten als „entartet“ eingestuft und mit einem Ausstellungsverbot belegt, sodass er gezwungen war, seinen Lebensunterhalt durch das Kolorieren von Werbefilmen zu verdienen. Der Zusammenbruch des Nazi-Regimes kam für ihn zu spät: Nur wenige Wochen nach Kriegsende starb er an den Folgen einer Wasservergiftung.

Das gegenwärtige Angebot an Gemälden blieb seit 2012 mit nur 28 Losen gegenüber dem vorigen Jahrzehnt konstant, lediglich die Quote der unverkauften Lose verbesserte sich mit elf Rückgängen geringfügig (knapp 40 Prozent). Wunderwalds Malerei findet außerhalb Deutschlands kaum Interesse: Hiesige Anbieter versorgen mit 90 Prozent immer noch den Löwenanteil der Ware. Bedeutsamer aber ist die stark rückläufige Preisentwicklung: Während in den Nullerjahren immerhin noch mehr als die Hälfte der verkauften Gemälde fünfstellige Preise erzielte, blieben seither rund 70 Prozent der Transaktionen unter 10.000 Euro. Bis zur Jahrtausendwende waren vereinzelt sogar Zahlen über 100.000 Euro machbar, doch in den vergangenen zehn Jahren gelang nicht einmal mehr ein Zuschlag über 20.000 Euro.
Das Ausbleiben solcher Spitzenwerte hat allerdings einen einfachen Grund: Preise in dieser Höhe waren ausnahmslos Wunderwalds Berliner Industrie- und Straßenmotiven vorbehalten, die im aktuellen Angebot schlichtweg fehlten. Bis auf eine Ausnahme, die nicht vermittelt werden konnte, hielt die Offerte überwiegend Landschaften und dörfliche Ansichten bereit. So zählte eine 1926 datierte „Memellandschaft“, die Grisebach, Berlin, Ende November 2012 für 18.000 Euro vermitteln konnte, noch zu den besten Abschlüssen des Jahrzehnts. Ein Jahr später verfehlte ein „Brunnen in Veles“, ein Souvenir von Wunderwalds Fronteinsatz in Mazdonien, bei Ketterer, München, dagegen knapp die Schätzung von 10.000 Euro. Ein Hammerpreis von 20.000 Euro für einen Blick auf einen „Garten in einem ostpreußischen Winterdorf“, der bei Nagel, Stuttgart, im Dezember 2014 versteigert wurde, reichte denn auch – traurig genug – für den Bestwert des Jahrzehnts. Das Haus hatte die um 1930 entstandene Holztafel lediglich mit 8000 Euro bewertet. Dagegen konnte Bassenge, Berlin, im Mai 2016 ein weiteres Ostpreußenmotiv aus der gleichen Zeit, diesmal mit „Ostpreußenkahn in der Wintersonne“, nur unter Schmerzen abgeben: Statt der erhofften 15.000 Euro kam der Käufer nämlich mit zwei Dritteln des Schätzpreises davon. Der Blick auf die letzten ärmlichen Häuser am Ortsausgang in einem „Dorf in der Mark“ aus dem Jahr 1930 brachte im Mai 2019 bei Irene Lehr, Berlin, nur 8000 Euro, nachdem er dort neun Jahre zuvor noch für 10.000 Euro abgegeben werden konnte. Ein Bildnis der Gattin des Künstlers mit dem neutralen Titel „Dame mit Papagei“ verbesserte sich gegen Jahresende bei Van Ham, Köln, immerhin um einen Tausender (Taxe 6000 Euro), während eine weitere „Sommerlandschaft“ im Juli 2020 im Wiener Dorotheum wenigstens die vorgeschlagenen 9000 Euro einlösen konnte, nachdem anderenorts bereits zwei Anläufe fehlgeschlagen waren. Eine Uferlandschaft mit den ungewöhnlich prominenten Rückenfiguren eines Camper-Paars beim beschaulichen „Wochenende am See“ vermittelte man bei Grisebach im vergangenen Dezember dann wie vorgesehen für 12.000 Euro. In diesem Jahr wurde bislang – zum ersten Mal seit 2008 – noch kein Gemälde angeboten.

RESÜMEE
- Mit nur 28 Losen blieb die Offerte im Vergleich zur vorigen Dekade unverändert; die Quote der vermittelten Lose verbesserte sich mit 60 Prozent nur geringfügig.
- Nach wie vor zeigt man im Ausland für Wunderwalds Signatur nur wenig Interesse, und so vorsorgten deutsche Häuser wie gehabt 90 Prozent der Offerte.
- Die Preise sind rückläufig: Nur noch 30 statt wie zuvor über 50 Prozent waren fünfstellig. Kein Zuschlag lag über 20.000 Euro, nachdem bis zur Jahrtausendwende vereinzelt sogar Werte über 100.000 Euro realisiert wurden.
- Der Wegbruch der Preisspitze erklärt sich durch den Mangel an den favorisierten Straßen- und Fabrik-Motiven aus der zweiten Hälfte der Zwanzigerjahre.