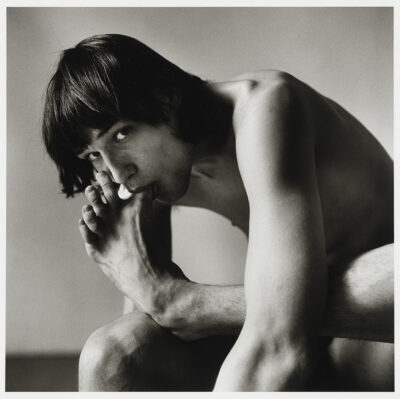Kosmische Formen
In seiner Kolumne „Was mich berührt“ stellt der Bestseller-Autor Daniel Schreiber Künstlerinnen und Künstler vor, die sein Leben begleiten. Folge 7: die Bildhauerin Barbara Hepworth
ShareVor ein paar Jahren verbrachte ich einige Monate in London. Es war ein langer, sanfter Frühling, wie man ihn eigentlich nur in England findet, und obwohl ich mich auf den Aufenthalt gefreut hatte, ging es mir schlecht. Ich hatte eine Trennung hinter mir und steckte in einer überraschend tiefen Schreibkrise. Und wie ich selbst schien sich auch die Welt um mich herum in einem Prozess der Auflösung zu befinden, oder zumindest nahm ich das so wahr. Zu den wenigen Tätigkeiten, die mir Linderung verschafften, gehörten das Joggen und Spazierengehen. Jeden Tag, kilometerlang. Von der Tower Bridge die Themse entlang zur Hochhausinsel von Canary Wharf, von dort zurück zum Limehouse Basin und zum Regent’s Canal, und von dort zum Victoria Park mit seinen malerischen Teichen und seiner chinesischen Pagode. Etwas anderes, was mich tröstete, war der Besuch von Ausstellungen. Ich sah mir alles an, machte keinen Unterschied zwischen einer Schau in der National Portrait Gallery und einer in der kleinen, experimentellen Chisenhale Gallery, fuhr vom Camden Arts Center im Norden zur Dulwich Picture Gallery im Süden der Stadt.

Einige der Arbeiten, die mir aus jener Zeit am stärksten in Erinnerung geblieben sind, stammen aus der Retrospektive „Barbara Hepworth. Sculpture for a Modern World“ in der Tate Britain, der damals ersten musealen Hepworth-Ausstellung in London seit 50 Jahren. Im nordenglischen Yorkshire aufgewachsen und viele Jahre in London beheimatet, starb sie 1975, im Alter von 72 Jahren, nach einer langen Krebserkrankung und einer zermürbenden Alkoholabhängigkeit, bei einem Feuer in ihrem Atelier in St. Ives, ihrem Rückzugsort an der Küste Cornwalls. Die Bronzen aus den letzten Jahrzehnten ihres Lebens wurden von unzähligen Museen gesammelt und zieren, zumindest in Großbritannien, zahlreiche Parks und Universitäten. Die berühmte „Single Form“ vor dem Gebäude der Vereinten Nationen in New York gehört zu den meistfotografierten Plastiken der Welt. Sie repräsentierte ihr Land bei den Biennalen in São Paulo und Venedig und bei der documenta in Kassel. Ihr öffentliches Engagement für die Nachkriegsmoderne hatten die Künstlerin mit der Simone-de-Beauvoir-Frisur und der Hosen-Anorak-Kopftuch-Uniform zu einer öffentlichen Figur gemacht. Dennoch blieb ihr der Eintritt in den Pantheon der Nachkriegsmoderne nach ihrem Tod versagt. Obwohl sie auf dem Kunstmarkt neuerdings immer wieder schwindelerregende Erfolge feiert, wurde sie lange kaum noch ausgestellt, und man schien bereit, sie nach und nach aus dem Kanon der Nachkriegskunst zu drängen. Die britische Bildhauerin umgibt ein kunsthistorisches Rätsel.
Während mir die Formensprache ihrer Arbeiten so vertraut war und ich einige ihrer Skulpturen – etwa ihre „Single Form“ – schon oft in meinem Leben gesehen hatte, wusste ich zu meinem Beschämen so gut wie nichts über sie. Die Ausstellung war eine Entdeckungsreise, die mich anrührte und sich auch in den Wochen nach meinem Besuch immer wieder in meine Gedanken stahl.

Hepworths Beitrag zur Skulptur der Nachkriegsmoderne war so enorm, dass ich mir beim Gang durch die Schau immer wieder die Augen rieb und mich fragte, wie es sein konnte, dass die Künstlerin nach ihrem Tod so in die zweite Reihe gedrängt worden war. Da waren sie alle, ihre überragenden Beiträge zur skulpturalen Sprache jener Zeit: Ihre frühen, dem Figürlichen verpflichteten Arbeiten, in denen sie das direct carving für sich entdeckte. Die Praxis, bei der Skulpturen direkt aus dem Material gehaut werden, war unter den Bildhauenden ihrer Zeit von der des Bronzegießens so sehr in den Hintergrund gedrängt worden, dass sie während Hepworths Studiums am Royal College of Art in London nicht einmal mehr unterrichtet wurde. Da war ihre ureigene abstrakte und so wiedererkennbare Formensprache, die sich durch ein genau austariertes, extrem elegantes Zusammenspiel von Volumen und Leere auszeichnete. Da waren ihre organisch wirkenden Skulpturen mit ihren Durchbrüchen, Leerräumen und Löchern, die sie manchmal mit Farbe nachbearbeitete und in denen positive und negative Formen zu einer neuen Wirklichkeit zusammenfanden. Ihre atemberaubenden string pieces, in denen sie die Hohlräume durch aufgespannte Schnüre betonte und damit eine Dynamik erschuf, die in der Plastik einen neuen Horizont öffnete. Die ernste Nachkriegsgeometrie, die Rotationen und Bewegungen ihrer turning forms, die Feinheit ihres Werks. Der Versuch, der Unordnung der Welt durch eine abstrakte Formensprache so etwas wie Ordnung, Ruhe und Harmonie zurückzugeben.
Der Höhepunkt der Ausstellung waren Hepworths „Guarea“-Arbeiten, deren kosmisch-organische Wirkung ich auch heute noch spüre, wenn ich an sie denke. Das Holz scheint noch zu atmen. Die Skulptur „Corinthos“ etwa strahlte eine Lebendigkeit aus, der ich mich kaum entziehen konnte. Die in sich gedrehte, weiß gefärbte Innenseite der großen Arbeit lenkte den Blick in ein hühnergottartiges Labyrinth, dass jede räumliche Logik ad absurdum führte und das Licht des Raumes in überraschenden Gradierungen reflektierte. Außen schimmerte in Myriaden dunkler Brauntöne die Maserung eines alten tropischen Baumes durch. Als hätte das Meer nach Dekaden sanften Sandschliffs einen von innen leuchtenden Stein an den Strand gespült.