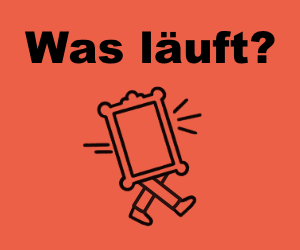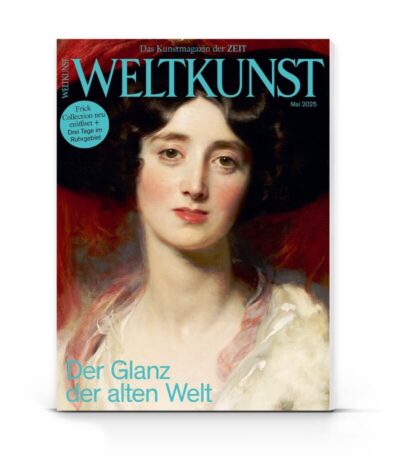Die Party läuft längst
Mit der Überblicksausstellung „When We See Us“ feiert das Kunstmuseum Basel die panafrikanische figurative Malerei der letzten hundert Jahre. Im Vordergrund steht bei vielen der gezeigten Positionen die selbstbewusste Freude an den eigenen Kulturen
Von
04.06.2024
/
Erschienen in
Weltkunst Nr. 227
Wenn der kongolesische Maler Chéri Chérin 2009 die Amtseinführung Barack Obamas in einem drei Meter breiten Historiengemälde feiert, dann könnten die Gratulanten nicht gewichtiger sein: Der erste schwarze US-Präsident und dessen First Lady Michelle Obama werden von historischen Aktivisten-Persönlichkeiten wie Martin Luther King und Nelson Mandela umkreist. Oder vom Politiker und ehemaligen Sklaven Frederick Douglass und der ersten afroamerikanischen Außenministerin Condoleezza Rice. Das gleicht fast schon einer Apotheose, zeigt aber auch, wie sehr sich eine weltweite Black Community mit diesem Wahlsieg identifiziert hat.
Raphael Adjetey Adjei Mayne aus Ghana, der auf Gesichter verzichtet und durch präzise Silhouetten Erkennbarkeit erreicht, widmet Obama 2021 ein klassisches Freundschaftsbild mit dem wiederum erfolgreichen Kehinde Wiley. In den opulenten, komplex gemusterten Porträts des Afroamerikaners werden gemalte Protagonisten wie Napoléon Bonaparte durch Schwarze ersetzt. Manche mögen die Bilder als Bling-Bling-Barock bezeichnen, doch Wiley gelingt es mit einem frappierend simplen Dreh, ein Missverhältnis vor Augen zu führen. Eria Nsubuga „Sane“ aus Uganda tut es dem Amerikaner gleich und bringt noch eine gute Spur Ironie ins Bild: Sein Porträt von Zora Neale Hurston erinnert an den Hof der französischen Königin Marie Antoinette. Die Schriftstellerin und Ethnologin aus Florida hat in den 1920er-Jahren begonnen, schwarze Kultur und Folklore festzuhalten und zu sammeln.

Es sind diese Beziehungen über Kontinente hinweg, die die Schau so ungemein verdichten. Das betrifft genauso die Spiritualität, ohne die für Tandazani Dhlakama ein schwarzer Alltag kaum denkbar ist. Zwischen Wassergeistern, Schamanen und Priestern treffen indigene, islamische und christliche Rituale aufeinander. In diesem Zusammenhang findet der in Nairobi aufgewachsene und in London ausgebildete Michael Armitage zu adäquaten Lösungen, zumal seine Malerei von einem vergleichbaren Stilmix gekennzeichnet ist. Versatzstücke der europäischen Kunstgeschichte treffen auf ein Schwarzes Lebens- und Glaubensgefühl, das in „The Dumb Oracle“ von 2019 einen fast ekstatisch entrückten Zustand ins Bild bringt.
Überhaupt ist es die Sinnlichkeit, die immer wieder ins Auge fällt. Wenn sich schwarze Körper zeigen, und das geschieht durchaus intim, dann zugleich voller Selbstbewusstsein. Zwei Frauen, die sich in ihren Leopardenprint-Kleidchen auf dem Sofa rekeln, sind durch nichts zu erschüttern. Die gerade mal 25-jährige Zandile Tshabalala aus Soweto rückt Frauen ins Zentrum ihrer Malerei, immer entspannt, sei es beim Herumalbern oder beim Abstecken des eigenen Terrains. Das gelingt auch Wangari Mathenges selbstgewisser Venus, die ihrem Publikum im blauen Badeanzug einen fragenden Blick zuwirft und damit jeden Voyeurismus lässig ad absurdum führt. Der Ball wird hier virtuos zu den Betrachtenden zurückgeworfen, und wer sich dem Zusammenspiel dieser oft farbstarken, mit frappierender Intensität auf die Leinwand gebrachten Szenerien öffnet, wird ganz erstaunliche neue Einsichten gewinnen.

Aber diese Wendung liegt schon im Titel. „When We See Us“ spielt auf eine fast gleichnamige Netflix-Serie von Ava DuVernay an. In „When They See Us“ geht es um fünf schwarze Teenager, die zu Unrecht beschuldigt werden, eine weiße Frau vergewaltigt zu haben. Indem „They“ durch „We“ ersetzt wird, ändere sich die Perspektive, und der Titel biete außerdem eine Plattform für Gegenargumente, sagt Koyo Kouoh. Das Leben von schwarzen Menschen sei immer wieder herablassend und meistens völlig falsch dargestellt worden, „also müssen wir viel mehr über uns selbst sprechen“. Deshalb legt auch Maja Wismer, im Kunstmuseum Basel zuständig fürs Zeitgenössische und mitverantwortlich für die Basler Umsetzung der Ausstellung, großen Wert darauf, dass dieses „We“ bei ihren Kolleginnen aus Südafrika bleibt. Am Zeitz MOCAA haben sie aus ihrer Sicht und aus ihrem Wissen heraus diese Ausstellung über „Hundert Jahre panafrikanische figurative Malerei“ konzipiert.
Das macht dieses Projekt so überzeugend, und in Basel hat man ja durchaus Erfahrung mit Kunst von schwarzen Künstlerinnen und Künstlern, das zeigen Einzelausstellungen über Theaster Gates, Sam Gilliam, Kara Walker und Carrie Mae Weems in den vergangenen Jahren. Aber auch das gehört zum neuen Ansatz. Während aus westlicher Sicht und durchaus wohlmeinend in einer Tour die Auswirkungen des Kolonialismus und die prekären Situationen thematisiert werden, setzen die MOCAA-Frauen auf die reine Freude an den schwarzen Kulturen. Für Kouoh ist sie so unvergleichlich und ebenso politisch wie sämtliche Erfahrungen von Rassismus. Zwar sei die Krise seit der Ankunft der ersten Kolonisatoren ein Dauerzustand und das Krisenmanagement längst zum kollektiven Wissen geronnen. Doch das würde auch immense Kreativität freisetzen. „When We See Us“ ist vielleicht das beste Beispiel dafür.
Service
Ausstellung
„When We See Us: Hundert Jahre panafrikanische figurative Malerei“,
Kunstmuseum Basel / Gegenwart,
bis 27. Oktober