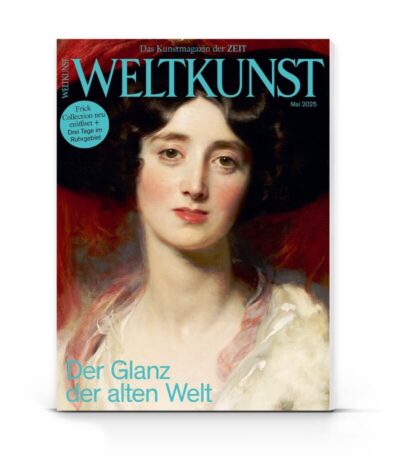Ein Kontinent im Fokus
In Deutschland hat Fotografie aus Afrika bislang kaum einen Markt, doch international sind immer mehr Sammler aktiv. Denn hier sind faszinierende Bildwelten zu entdecken. Und die Preise werden weiter steigen
Von
16.08.2021
/
Erschienen in
Weltkunst Nr. 153
Guy Tillim verfolgte für die Straßenfotografie einen neuen Ansatz, indem er etwa in seiner Serie „Museum of the Revolution“ die Grenzen des Bildes analog dem menschlichen Blickfeld verschob. So sehen wir auf seinen Fotos, was wir mit eigenen Augen wahrnehmen könnten, wenn wir uns an die Schauplätze begeben würden. In diesem Fall sind es eben nicht die krisenhaften Momente, die üblicherweise durch die Medien kommuniziert werden, sondern es ist ein Afrika wachsenden Wohlstands und steigender Bildungschancen wahrzunehmen.
Santu Mofokeng, der ebenfalls als Straßenfotograf begann, versuchte, den „Kampfjournalismus“ der Apartheidzeit mit einer Gegenüberstellung von einfühlsamen Aufnahmen aus Stadt und Natur zu unterlaufen. In seinem „Black Photo Album“ verzichtete er ganz auf die eigenen Fotos. Es ist ein Archiv alter privater Familienfotos, die er kopierte, scannte und retuschierte. Ein Gegenmodell zu den riesigen Sammlungen von Passbildern, Porträts und amtlichen Dokumentationen, mit denen der Staat seinen Kontrollanspruch gegenüber Menschen dunkler Hautfarbe zum Ausdruck brachte.
Tradition der Fotostudios
Kulturell steht Südafrika für sich. Wer von hier aus in die Länder Ost- oder Zentralafrikas reist, fühlt sich dort genauso fremd wie ein Europäer. Aus westlicher Perspektive ist ein Markt in Ost- und Zentralafrika so gut wie nicht existent. Das heißt aber noch lange nicht, dass es keine Künstler gibt. Samuel Fosso zum Beispiel, Jahrgang 1962, eröffnete 1975 im Alter von 13 Jahren sein eigenes Fotoatelier in Bangui, der Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik. Tagsüber arbeitete er im Kundenauftrag; abends richtete er die Kamera auf sich selbst, um die Filme vollzukriegen. Er experimentierte mit Kleidung, Pose und Beleuchtung.
Was dabei herauskam, widersprach der kommerziellen Praxis der Studioporträtfotografie ebenso wie den ethnografischen Zerrbildern von Afrika. In seiner berühmt gewordenen Serie „African Spirits“ schlüpfte er in die Rolle von Aktivisten der afrikanischen Befreiungsbewegung. Fosso beschrieb diese Bilder als „eine Hommage an die Führungsfiguren, die versuchten, uns zu befreien und uns unsere Würde als Afrikaner und Schwarze wiederzugeben“.
Die Mehrheit der Fotografen Afrikas arbeitete nicht draußen, sondern wie Fosso in der viel älteren, bis tief ins 19. Jahrhundert reichenden Tradition der Fotostudios. Berühmt wurden die Ateliers von Bamako im westafrikanischen Mali, wo Seydou Keïta und Malick Sidibé tätig waren: Keïta in der späten Kolonialzeit, Sidibé, auch „das Auge von Bamako“ genannt, seit den 60er- Jahren. Wer heiratete oder ein offizielles Foto brauchte, wandte sich an Keïta, wer ein Fest gab, engagierte seinen etwas jüngeren Kollegen, der die Szenen kühn anschnitt und aus ungewöhnlichen Perspektiven fotografierte. Zu Sidibés erfolgreichsten Bildern gehören denn auch die Rückenansicht von Twisttänzern (1965) oder ein tanzendes junges Paar („Nuit de Noël“, 1963). Sie tauchen immer wieder in den Auktionen auf und wurden schon mit bis zu 24.000 Euro bewertet.
Klassiker aus Mali
Keïta war wie Sidibé in seiner Region weithin bekannt, als er Anfang der Neunzigerjahre von André Magnin aufgespürt wurde. Was Europa und Amerika dann zu sehen bekam, revolutionierte das Bild von Afrika. Keïta war damals rund 70 Jahre alt, sein Studio längst Vergangenheit. Aber mehrere Tausend Negative, die er sorgfältig verwahrt und bereits mithilfe der französischen Fotografin Françoise Huguier restauriert hatte, gab es noch.
Als Keïta zwischen 1948 und 1962 sein Fotostudio betrieb, rannte ihm die Mittelklasse von Bamako die Türen ein, weil er sie auf seinen Schwarz-Weiß-Bildern so vorteilhaft zu inszenieren verstand: vor ornamentalen Stoffhintergründen und mit standesgemäßen Requisiten wie Armbanduhren, Radios, Schmuck, Blumen, Autos und Motorrollern. Dann kam 1962 die Unabhängigkeit, und was Keïta machte, galt plötzlich als überholt. Er schloss das Studio und ging als Fotograf in den Staatsdienst.

In Lagos begann J. D. ’Okhai Ojeikere 1968 mit seiner über 40 Jahre verfolgten Dokumentation von Haartrachten nigerianischer Frauen. In fast keiner Sammlung afrikanischer Fotografie fehlen seine grafischen Rückansichten von geflochtenen, verdrillten und einfallsreich konstruierten Frisuren.
Eine jüngere Generation setzte andere Prioritäten. Lagos wächst so rasant und ändert sich ständig. Künstler reagieren darauf wie Olumuyiwa Olamide Osifuye, der 2002 für die Documenta 11 einen Foto-Essay produzierte. Unter schwierigen Bedingungen, weil von den misstrauischen Bewohnern das Kamera-Auge noch immer mit staatlicher Überwachung assoziiert wurde. Im Kongo verarbeitete Sammy Baloji in breitformatigen Fotocollagen die Traumata, die der koloniale Raubbau an den Bodenschätzen in der Provinz Katanga zurückließ.
Fotokunst aus Afrika wird seit noch nicht einmal 30 Jahren gesammelt und vermarktet. Zunächst ging das Interesse von Europa und den USA aus. Heute haben die Künstler auch auf dem eigenen Kontinent Sammler, vor allem in Südafrika. Vermarktet werden sie von wenigen spezialisierten Galerien, zu Preisen zwischen 3500 Euro – etwa für Tillims Porträtserie über Bürgerkriegsflüchtlinge in Kunhinga – bis hin zu niedrigen sechsstelligen Summen für David Goldblatts Serien aus der Zeit der Apartheid.

Auf dem internationalen Auktionsmarkt sind Goldblatt und Hugo präsent, Tillim ein wenig; die Altmeister Keïta und Sidibé werden mit Abstand am erfolgreichsten gehandelt. Hier bewegen sich die Preise zwischen hohen vier- und zuweilen mittleren fünfstelligen Summen. Wer mitbietet, tut gut daran, sich besonders bei Keïta mit der Provenienz zu befassen. Um Authentizität und Bildrechte wurde bereits zu Lebzeiten des Künstlers gestritten und später prozessiert. Inzwischen hat der Nachlass Keïtas die Aufsicht über alles, was mit dem verbliebenen Material noch geprintet werden kann. Hier gelten nach Einschätzung westlicher Beobachter andere Maßstäbe der Auflagenverwaltung als sonst am Markt üblich, denn die von der Verwertung profitierende Familie ist groß.
Auflagenzauber
Dass überhaupt ein Markt für die Fotokunst Afrikas in Gang kam, geht auf das Konvolut von Negativen Keïtas zurück (offenbar einige Hundert), die André Magnin Anfang der Neunziger mitnahm und von denen er Abzüge anfertigen ließ. Das brachte viel in Bewegung. Denn nicht nur revidierte Keïtas Werk die Wahrnehmung von Afrika, in der Folge erschlossen sich auch die Œuvres von Sidibé, Ojeikere, Fosso und anderen.
Die Aneignung besaß aber auch etwas Gewalttätiges. Denn die Anmutung der großformatigen, kontrastreich geprinteten Abzüge von Keïta, mit denen die New Yorker Galerie Gagosian 1997 ihr Publikum begeisterte (für damals bis zu 16.000 Dollar), hat nicht viel mit den kleinen Bildern zu tun, die Keïta für ein paar Dollar einst selbst für seine Kunden, deren Familie und Freunde entwickelt hatte.
Hier geht’s weiter: der Service des Sammlerseminars zur afrikanischen Fotografie.