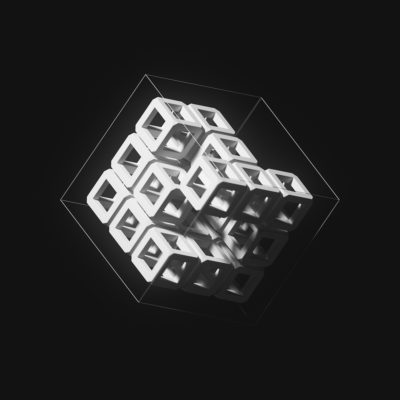Vom Glitzern der Pixel
Das Gesamtkunstwerk ist zurück: Immer mehr Ausstellungen setzen mit virtuellen Räumen oder großen Lichtinstallationen auf das Zauberwort immersiv. Wenn die Inszenierung gelingt, sorgt sie für emotionale Erlebnisse – und sogar für Erkenntnis
Von
20.10.2021
/
Erschienen in
WELTKUNST Nr. 190
Der Gesang der Pixelfee hat meinen Willen gestohlen. Ich sitze in einer dunklen Ecke des Raums auf dem Boden und blicke gebannt auf das mysteriöse Farbenspiel. Vor meinen Augen baumeln Vorhänge aus durchsichtigen Plastikkristallen. In diesen leuchten im schnellen Wechsel Lämpchen auf: eisblau, gelb, hellgrün, rosa, tiefrot, violett, wieder blau. Musik schwebt im Raum, lang gezogenes Synthesizerfiepen, die schrägen Akkordwechsel einer elektrischen Orgel. Wie aus dem Nichts ertönt eine körperlose gedämpfte Stimme, die in ihrer emotionalen Intensität mehr kreischt, als dass sie singt: „I see / you see / I see you / you see me seeing / I want to see how you see!“ Ich sehe dich, du siehst mich sehen. Schön und gut – aber wer ist ich? Und wer du? Bin ich noch abseits der Kunst oder längst schon ein Teil von ihr?
Pipilotti Rists „Pixel Forest“ war 2018 in Arles zu sehen. Die hypnotische Rauminstallation, die auch bis zum 6. Juni 2022 bei Rists Überblicksschau „Big Heartedness, Be My Neighbor“ im Museum of Contemporary Art in Los Angeles gezeigt wird, ist ein schönes Beispiel dafür, wie die Schweizer Künstlerin ihr Publikum umgarnt, es umarmt, bis es hineingezogen wird in ihre Werke und für lange Zeit in ihnen verschwindet. Sprechen wir hier von immersiver Kunst? Dieser Begriff ist gerade in aller Munde, nimmt überhand in Einladungen zu Ausstellungen, die einem alle eine Erfahrung versprechen, die man im ursprünglichen englischen Wortsinne von Immersion als ein „Eintauchen“ bezeichnet. Vor allem im Bereich der Digitalkunst wollen momentan alle immersiv sein. Was aber diese immersive Kunst genau ist, können nur wenige exakt sagen.
Immersion seit dem 13. Jahrhundert
Einer, den man fragen sollte, weil er sich sehr gut auskennt, ist Thomas Oberender. Der Intendant der Berliner Festspiele hat 2016 die Programmreihe „Immersion“ ins Leben gerufen, in der die Kunst bis heute den Betrachtern auf experimentelle und ungewohnte Weise begegnet. So fand Mitte September im Rahmen der Berlin Art Week die vierte Ausgabe des Formats „The New Infinity“ statt, in der Künstlerinnen und Künstler das Zeiss-Großplanetarium in Berlin bespielen. Oberender erzählt, dass er in der Beschäftigung mit dem Immersionsthema seit ein paar Jahren begrifflich zwischen immersiver Wirkung oder Erfahrung und einem „immersivem Genre“ trennt: „Wenn wir uns einfühlen, wenn die Grenze zum Werk überschritten ist und wir im Werk sind, dann ist das eine immersive Erfahrung, die so alt ist wie die Kunst selbst. Ein Gemälde aus dem 13. Jahrhundert kann diese Wirkung genauso haben wie ein Virtual-Reality-Erlebnis“, erklärt er. „Warum uns dieses Thema im Moment dann doch noch stärker interessiert, ist, weil es sich eben zu einem eigenen Genre entwickelt hat, und das ist noch relativ jung. Immersive Prozesse im Genresinne entstehen immer dann, wenn die ›vierte Wand‹ verschwindet, wenn Sie eintreten dürfen oder sollen in das Geschehen, und zwar in einem physischen Sinne. Und das Kunstwerk Sie umgibt und Sie ihm nicht mehr gegenüberstehen, sondern Teil davon sind.“
Eine der immersivsten Erfahrungen der jüngeren Vergangenheit war die Ausstellung „Piccadilly Community Centre“ im Jahr 2011, bei der Christoph Büchel die Galerie Hauser & Wirth in London in ein Freizeitheim verwandelte: Der Schweizer Künstler ließ stilecht verschrammtes Linoleum verlegen und die Wände avocadogrün streichen, er baute einen Secondhandshop ein, eine Cafeteria, Multifunktionsräume. Anschließend überließ er das Haus der Londoner Bevölkerung, die dort Yoga- oder Malkurse abhalten konnte. Mit seinen Einbauten hatte Büchel die White-Cube-Aura der Galerie zum Verschwinden gebracht. Wo sonst Kunst hing, fand jetzt Kunst statt – und zwar so täuschend lebensecht, dass die Illusion die Grenze zur Realität überschritten hatte. Das kritische Bewusstsein schwand in dem Maße, in dem man in der Cafeteria am stark gebrühten Schwarztee aus der Thermoskanne nippte.
Überschreiten der Grenze zum Werk
„Wenn ein Betrachter von einem hochdetaillierten, 360 Grad umspannenden Illusionsraum umgeben ist, kann er nur mit größten Schwierigkeiten die Distanz zum Werk erhalten oder es objektivieren“, schreibt der Kunsthistoriker und Medientheoretiker Oliver Grau in seinem Buch „Virtual Art. From Illusion to Immersion“ (2003), wobei er dieses Wirkungsprinzip auch in den Fresken römischer Villen in Pompeji oder in den Panoramen des 19. Jahrhunderts wiederfindet. Das Gegenteil von Graus Immersion ist das, was der Erziehungswissenschaftler Horst Rumpf in einem Aufsatz von 1995 als die „Gebärde der Besichtigung“ beschreibt: der bildungsbürgerlich eingeübte, ein Gemälde nur kurz und oberflächliche streifende Blick, gepaart mit wissendem Nicken oder zwanghaftem Hinweisschildchen-Lesen. „Die Objekte werden zu Kulturdelikatessen“, schreibt Rumpf. Eben diese passiv-konsumistische Haltung sucht die immersiv wirkende Kunst zu durchbrechen und den Betrachter in die Teilnahme zu verwickeln. Wobei offensichtlich ist, dass die künstlerischen Strategien den Zeitgeschmack und die Wahrnehmungsgewohnheiten des Publikums berücksichtigen müssen – denn Freskenräume und Panoramen stürzen heute weniger Menschen in ehrfürchtige Immersion als in den Epochen, in denen diese Anblicke neu waren.
Wie reichhaltig die Trickkiste der vereinnahmenden Kunst seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bestückt ist, zeigte 2018 die Schau „Welt ohne Außen. Immersive Räume seit den 60er Jahren“ im Berliner Gropius Bau, kuratiert von Thomas Oberender und dem Künstler Tino Sehgal. Die Rauminstallationen aus den Sixties der kalifornischen Light-and-Space-Künstler Larry Bell und Doug Wheeler sorgten dabei genauso für erstaunte Gesichter wie die flackernde „Light Wall“ von Carsten Höller oder Jeppe Heins „Moving Bench“, die sich, durch Sensoren aktiviert, mitsamt den Pausenbedürftigen darauf in Bewegung setzte. „Das Thema Immersion ist bedeutungsvoller geworden durch die Erfindung der Technologien, die diesen Prozess beschleunigen und visualisieren“, sagt Oberender. „Der wirkungsästhetische Boom des Immersionsbegriffs hat in den Neunzigerjahren eingesetzt durch die Medienkunst und das Entstehen von Virtual-Reality-Situationen.“

Wird heute von immersiver Kunst als Genre gesprochen, sind zumeist virtuelle Erfahrungen oder Lichträume gemeint. Auch Letztere haben seit der Moderne eine Entwicklung durchlaufen – von László Moholy-Nagys frühem Experiment, dem „Licht-Raum-Modulator“ (1922–1930), über das immer noch sichtbar mechanische „Lichtballett“ (1959) des Zero-Künstlers Otto Piene oder die nächtlichen Beleuchtungsspektakel der Son-et-lumière-Tradition (ab 1952) bis hin zu James Turrells gigantischer Lichtnebelmanifestation 2009 in Wolfsburg.
Erhellender Faktor Licht
Licht als gestalterisches Mittel kann eine enorme immersive Wirkung entfalten – es kann aber ebenso grell die Mängel eines Ausstellungskonzepts erhellen: Die Schau „Van Gogh – The Immersive Experience“ in diesem Sommer in der Station Berlin war genau das nicht, was sie anpries. Denn ein Hineingleiten in die Kunst wurde durch die wiederkehrende Erkenntnis verhindert, dass die Großprojektion und digitale Animation weltberühmter Kunstwerke noch lange kein erfüllendes Erlebnis ist. Das Ineinander-Morphen verschiedener Gesichter aus Porträtgemälden des Malers rief Michael Jacksons Musikvideo „Black or White“ aus dem Jahr 1991 in Erinnerung. Irritierend war auch der Pferdekarren, der in der Giganto-Digitalversion des Bilds „Die Ernte“ (1888) zum Teil rückwärts fuhr. Prompt sprang das kritische Bewusstsein an, die Gebärde der Besichtigung lauerte schon im Hinterkopf. Wie es besser geht, zeigt der türkische Künstler Refik Anadol, der mithilfe künstlicher Intelligenz aus Datensammlungen immersive Werke erschafft, die das Versprechen einer „dynamischen Raumwahrnehmung“ tatsächlich einhalten. Kürzlich verkaufte die Berliner König Galerie über ihre neue Handelsplattform misa.art eines seiner Datengemälde als NFT-Unikat für 151 725 Euro. Ein wahres Abtauchen ins Werk geschieht allerdings erst, wenn Anadol in Rauminstallationen vor den Betrachteraugen ganze Wände im Pixelsturm auflöst.