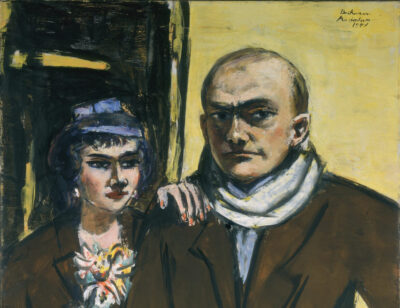Heimkehr nach Benin
Zum ersten Mal ist es einem afrikanischen Staat südlich der Sahara gelungen, bedeutende Kunstwerke aus Europa zurückzubekommen. Nun sind sie in einer Ausstellung in Cotonou zu sehen
Von
07.04.2022
/
Erschienen in
WELTKUNST Nr. 199
Hier verbinden Arbeiten aus drei Generationen beninischer Künstlerinnen und Künstler die alten zurückgekehrten Werke mit der heutigen Zeit. Léa Awunou Roufaï, Direktorin der Galerie Nationale du Bénin und Kuratorin der Ausstellung, setzt sie meisterhaft in Beziehung zueinander. Lebende Legenden sind dabei, wie Georges Adéagbo, Meschac Gaba oder Romuald Hazoumè; und Künstler wie Cyprien Tokoudagba (1939–2012) und Yves Apollinaire Pèdé (1959–2019), die in wegweisenden Ausstellungen wie „Africa Remix“ in Düsseldorf 2004 international reüssierten. Von der jüngeren Generation sind viele in der Diaspora aufgewachsen oder leben zwischen den Welten: etwa der 1987 in Frankreich geborene, in Japan ausgebildete Keramiker King Houndékpinkou, die vielfach ausgezeichnete Fotografin Laeïla Adjovi, Jahrgang 1982, oder der 34-jährige, in Amsterdam sozialisierte Videokünstler Thierry Oussou. Alle zusammen holen die alten Skulpturen aus Abomey ins 21. Jahrhundert. Sie erinnern ohne Worte daran, dass auch die alten Palasttüren und die Tiermenschstatuen das Werk namhafter Künstler waren, bevor sie als anonyme Kriegstrophäen und exotische Kuriositäten ins Musée d’Ethnographie du Trocadéro nach Paris kamen. Sie zeigen darüber hinaus mit visueller und intellektueller Schlagkraft, dass sie aus dem westafrikanischen Koordinatensystem heraus in den Diskussionen um die globale Zukunft vieles beizutragen haben.
In der Serie „Agbara Women“ fragt der in der Elfenbeinkünste geborene Ishola Akpo nach dem Platz von Frauen in der Gesellschaft und schafft in genähten Collagen und Fotografien großartige Porträts von anonymen Königinnen unserer Zeit. Die futuristischen Motorradhelmskulpturen von Emo de Medeiros setzen Mobilität, Technologie, Kapital und Imagination mit der Kosmogonie der Vodun-Religion in Verbindung. In einer Fotoserie von Laeïla Adjovi erhält eine anmutige, androgyne und in kerkerähnlichen Räumen eingesperrte Gestalt bunte Flügel aus Stoffstreifen: „Malaïka erzählt uns, dass wir Afrikaner, wenn wir uns erheben – und ja, das tun wir –, dies nach unseren eigenen Maßstäben tun müssen“, erklärt sie.
Tatsächlich setzt diese Ausstellung Maßstäbe. Die Republik Benin zeigt, dass alle Stereotype zur vermeintlichen Unfähigkeit von Afrikanerinnen und Afrikanern, sich mit dem eigenen Kulturerbe auseinanderzusetzen, billige Ausreden waren, um die aus dem 19. und 20. Jahrhundert übernommenen musealen Ordnungen (alles in Europa, fast nichts in Afrika) zu zementieren. In der neuen geopolitischen Ordnung des afrikanischen Kulturerbes wird ein Land wie Benin mit seinem neuen historischen, staatlich gesicherten Kunstbesitz zukünftig in der Lage sein, mit anderen Museen weltweit selbstbestimmt über mögliche Leihgaben und Ausleihen zu sprechen oder Ausstellungstourneen zu planen. Auch die Geografie des Kunstmarktes für zeitgenössische Kunst aus Afrika wird sich ändern, das zeigte bereits im Umfeld der Ausstellungseröffnung die starke Präsenz reicher Sammler und Sammlerinnen aus dem Nachbarland Nigeria, welche die etablierten, ebenfalls angereisten, vor allem französischen Sammler westafrikanischer Kunst sichtlich verunsicherten. Und geopoetisch zeigt sich jetzt schon, wie auf dem afrikanischen Kontinent und darüber hinaus die Kreativität künftiger Generationen von solchen Ausstellungen angeregt werden wird. Vor 115 Jahren zeichnete Le Corbusier, kaum zwanzigjährig, die damals mit militärischer Gewalt nach Frankreich gebrachten Königsstatuen von Dahomey im ethnografischen Museum in Paris. Er erinnerte sich Jahre später daran, wie sehr diese Werke ihn geprägt haben. Jetzt ist es die kreative Jugend aus Benin und im gesamten Westafrika, die sich von den Werken anregen lassen wird. Diese Ausstellung markiert den glücklichen Beginn einer völlig neuen Ära. Die Arbeit hat sich gelohnt.