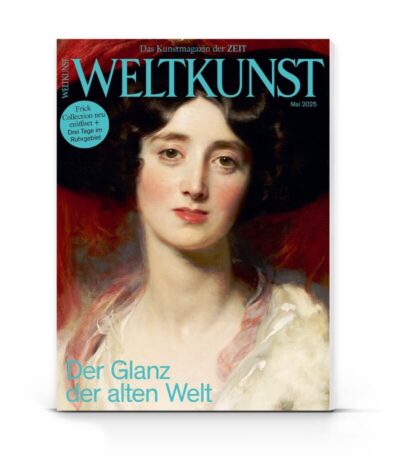Europas schönste Gärten
Schon die Ägypter nutzten die Schönheit der Pflanzen, um Träume vom irdischen Paradies wahr zu machen. Gärten können Kunsterlebnisse für alle Sinne sein. Wir stellen Parks von Oxford bis München vor
Von
19.07.2022
/
Erschienen in
Weltkunst Nr. 174
Als die französische und dann die englische Gartendoktrin ihre Wirkkraft verloren hatten, begannen im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts Experimente, landschaftliche Motive mit geometrischer Strenge zu verweben. Zuweilen reihten sich Motive und Szenerien in fast filmischer Weise aneinander. In der Pariser Vorstadt Boulogne-Billancourt ließ sich der Bankier Albert Kahn einen Themengarten anlegen, der Wälder, französische Gärten und japanische Gartenfantasien zusammenfasste, im rhythmischen Wechsel mal gegenteilige, mal sich ergänzende Stimmungsbilder kreierte, die ihren Widerhall in der menschlichen Psyche finden sollten. So entstand ein Garten, dessen Wirkung nicht allein aus der Struktur entstand, sondern aus der farbigen und grafischen Beschaffenheit jeder einzelnen Pflanze.
Die Moderne entwickelte keinen einheitlichen Gartenstil. Vereinzelt gibt es Versuche, wie in der Villa de Noailles in Hyères kubistische Elemente aus der Malerei in den Garten zu verpflanzen, aber meist sieht es anders aus. Vor allem in Deutschland verfestigte sich die Idee des Staudengartens, der maßgeblich von dem Potsdamer Pflanzenzüchter Karl Foerster und dem Gartenarchitekten Hermann Mattern entwickelt wurde. Mehr als fünfzig Jahre waren die Stadtparks, Bundesgartenschauen und ungezählte Privatgärten bestimmt von großen Rasenflächen, begleitet von Staudenbeeten mit prachtvoller Blüte vom Vorfrühling bis in den Spätherbst, nach außen hin durch Büsche, Hecken und kleine Bäume abgegrenzt.
Obwohl sich die Gartenarchitektur von ihren Herrschaftsgesten längst befreit hat, kommt sie vom Landschaftsgarten nicht los. Als Idealbild von naturhafter Schönheit ist er unvergessen. Ins Monumentale erhöht und gleichzeitig ins Heitere gekehrt, gelang 1972 im Münchner Olympiapark das Kunststück, Architektur und modellierte Massen eines Trümmerbergs ästhetisch zu verschmelzen. Die leichten, geschwungenen Zeltdachkonstruktionen von Frei Otto und die in Bodenmulden eingegrabenen Sportbauten von Günter Behnisch verbinden sich mit Günther Grzimeks sanft gerundeten Hügeln, den amorphen Wasserflächen und gezielt gesetzten Baumgruppen zum Exempel eines modernen, demokratischen Landschaftsgartens.


Spannend ist die Entwicklung des innerstädtischen Gartens. Fern von den Vorstellungen der traditionellen Stadtparks, die entweder neobarock oder im Sinne des Landschaftsgartens angelegt wurden, experimentieren Gartenarchitekten seit zwei Jahrzehnten mit neuen Formen und Konzepten. Ein zentrales Thema ist dabei die Frage, wie die Kommunen mit den verödeten Brachen der Industrialisierung umgehen. So entstand der gartenkünstlerisch sehr interessante Maximilianpark in Hamm auf dem Gebiet einer stillgelegte Zeche. In Berlin wurde der von rohen Materialwechseln geprägte Park am Gleisdreieck, einem ehemaligen Güter- und Rangierbahnhof, auf Anhieb zu einem der beliebtesten Freizeitgebiete der Stadt.
Pioniere des neuen städtischen Gartens sind Patrick Berger, Philippe Mathieux und Jacques Vergely. Ab 1993 verwandelten sie in Paris eine hoch gelegene Bahntrasse zu einem 4,5 Kilometer langen Parkwanderweg durch das 12. Arrondissement. Statt allein künstlerisch-ästhetische Gestaltungsideen der Gartengeschichte zu variieren, traten eindeutig ökologische und Nutzungsfragen in den Vordergrund. Die Coulée verte RenéDumont wurde zum Vorbild des populären New Yorker High Line Park (2006–19). So fanden die alte Industrie und die noch ältere Gartenkunst zu einer neuen Symbiose.