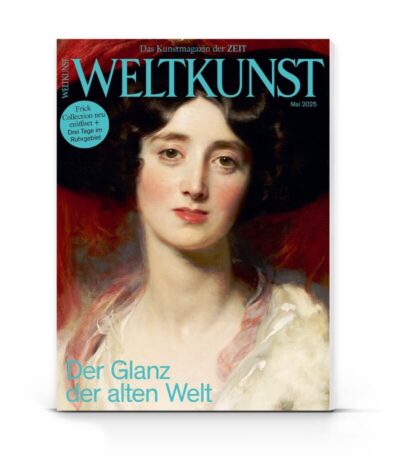„Jeder stellt sich hier auf den Prüfstand“
Julia Draganović, die Direktorin der Deutschen Akademie Villa Massimo in Rom, über Konkurrenz im Künstlerhaus, ständige Erreichbarkeit und das Ende der Kleiderordnung
ShareGibt es Überlegungen, die Struktur der Villa und der Stipendienvergabe europäischer zu denken?
Ich habe das kurz vor den letzten Bundestagswahlen in Deutschland zum Thema gemacht. Noch gilt: Deutsche Steuergelder sollen an Leute gehen, die in Deutschland Steuern zahlen. Das ist ein Grundsatz, den ich allein nicht ändern kann. Ich fände es aber superspannend und hilfreich, das anders zu denken. Es gibt da durchaus Modelle. In der Villa Medici, der französischen Akademie in Rom, ist die Grundvoraussetzung für ein Stipendium, dass man Französisch spricht. Die Amerikaner vergeben in jedem Jahr ein Stipendium an italienische Künstler:innen, um so eine weitere Brücke in das Gastland zu bauen. Für ein Stipendium in der Villa Massimo braucht man keine deutsche Staatsbürgerschaft, aber man muss seit mindestens fünf Jahren in Deutschland gemeldet sein. Die neun Preisträger:innen werden von vier Fachjurys ausgewählt. Die Ernennungen der nächsten beiden Jahrgänge spiegeln zum Glück eine gewisse Internationalität innerhalb der deutschen Gesellschaft. Ich würde mir wünschen, dass man zumindest mit den Kurzzeitstipendien einen weiteren Spielraum hat. Diese Stipendiat:innen darf ich als Direktorin der Staatsministerin für Kultur und Medien vorschlagen, wobei ich möchte, dass diese Vorschläge in enger Zusammenarbeit mit Institutionen vor Ort entwickelt werden. Ich habe da viele Ideen und würde gern einen Versuchsballon starten.
Zunehmend arbeiten Künstlerinnen und Künstler im Kollektiv, schauen wir nur auf die documenta 15. Oft passen diese Strukturen nicht zu den Bedingungen von Stipendien. Vor zwei Jahren war das Künstlerduo FAMED in der Villa Massimo, jedoch mussten sich die beiden das monatliche Geld von 2.500 Euro teilen. Gibt es Möglichkeiten, das Statut der Villa Massimo dahingehend anzupassen?
Ich setze mich stark dafür ein, dass das geändert wird. Something Fantastic aus dem aktuellen Jahrgang sind zu dritt und FAKT, die Architekten im vorletzten Jahrgang, waren zu viert. Die Tendenz zur Kollaboration nimmt zu und es ist nicht zu erwarten, dass das weniger wird. Selbst bei Schriftsteller:innen gibt es inzwischen Kollektive. Ich halte es für wichtig, dass für Kollektive das Preisgeld erhöht wird, insbesondere, da das ein Ort ist, an dem sich interdisziplinäre Zusammenarbeit anbietet. Auch für Interdisziplinarität wünsche ich mir bessere Förderstrukturen.

Sind die Werke, die bisher in der Villa Massimo entstanden sind, entsprechend aufgearbeitet und publiziert?
Nein. Es gibt die Jahresberichte und einige Publikationen zur Geschichte der Villa, die mein Vorgänger Joachim Blüher publiziert hat. Auch Elisabeth Wolken, die Großenkelin des Gründers Eduard Arnhold und Direktorin der Villa Massimo von 1965 bis 1993, hat zur Geschichte geforscht. Sie lebt noch immer in der Nachbarschaft. Wir hätten noch extrem viel Material und einen großen Personenkreis, der Zeugnis ablegen könnte, um die Geschichte der Villa aufzuarbeiten. Ich finde das sehr spannend und dringlich, die Zeitzeugen zu befragen, aber wir bräuchten dazu wissenschaftliche Mitarbeiter. Wir haben jetzt zumindest damit angefangen, die noch lebenden Direktor:innen zu interviewen. Auch der Austausch mit den ehemaligen Stipendiat:innen ist wichtig. Ich habe das Gästeprogramm geöffnet und gesagt: Wer mal Stipendiat:in war und in Rom an seine Tätigkeiten und Netzwerke anknüpfen will, ist jederzeit in einem der Gästeappartements der Villa willkommen. Die Ehemaligen sind eine große Gemeinschaft, die gemeinsam und im Austausch viel schaffen könnte. In diesem Sinne ist die Villa Massimo eine Metapher fürs Leben: Du musst es behandeln, pflegen und genießen wie einen Paradiesgarten, als wäre alles hoch wertvoll und gehörte dir, und dir doch gewahr sein, dass dir nichts gehört. Es ist alles nur geliehen! Das ist die große Lebenslektion der Villa Massimo.
Service
Ausstellung
„Eppur si muove – und sie bewegt sich doch! Villa Massimo zu Gast im Japanischen Palais“,
bis 25. September
Dresden, Japanisches Palais