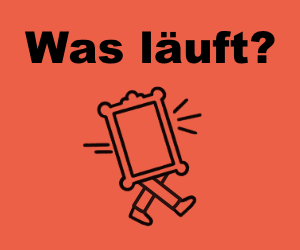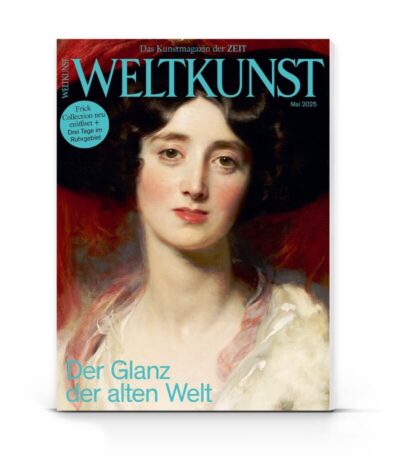„Kunst muss sich ins Leben integrieren“
Manuela Alexejew und Carlos Brandl haben mit Passion und Spürnase eine hochkarätige Kunstsammlung aufgebaut. Davon erzählt nun ein Buch im Steidl-Verlag. Ein Hausbesuch in Berlin
Von
31.10.2021
/
Erschienen in
WELTKUNST Nr. 184
Nach dem Studium eröffnete sich für Alexejew zunächst eine Welt, die mit der Liebe zur Kunst auf den ersten Blick nur wenig zu tun hat. Sie begann, als Stewardess zu arbeiten. Nicht bei irgendeiner Airline, sondern beim Inbegriff für mondänen Jetset-Lifestyle: Pan Am. In den 1970er-Jahren, als Fliegen noch Luxus war, eröffnete dieser Job der attraktiven jungen Frau, die nebenher modelte, einen Zugang zur Welt der Schönen und Reichen. Wochenendtrips nach Mykonos, eine Nacht an der Bar des legendären „Studio 54“ in New York, wo sie Truman Capote zuprostete und neben Sophia Loren tanzte – ihr Leben zu dieser Zeit klingt wie ein Film. Als sie 1978 Carlos Brandl kennenlernte, begannen sie gemeinsam, durch die Welt zu jetten. Zu ihren Trips nach New York gehörte bald auch regelmäßig der Besuch der großen Auktionen von Sotheby’s und Christie’s, die ihre Versteigerungen damals mit einem Aufwand und Glamour inszenierten, der in unserer profanisierten und durch Corona stillgelegten Welt heute kaum mehr vorstellbar ist. „Die Leute kamen in Abendgarderobe zu den Auktionen“, erzählt Manuela Alexejew von den Begegnungen mit der New Yorker Kunst-Upperclass.
Auch der Lebensweg von Carlos Brandl ist ungewöhnlich und unbürgerlich. Aufgewachsen in Hamburg-St.-Pauli als Sohn eines Musikmanagers und einer Sängerin, die unter dem spanischen Pseudonym Ramona Morales im Schlagerbusiness der Fünfzigerjahre exotischen Flair versprühte, versuchte er sich früh und mit Erfolg als Unternehmer. Nach der Trennung der Eltern – die Mutter heiratete einen vermögenden Fleischfabrikanten – und der Übersiedelung nach Westberlin gründete er seine eigene Firma. Mit dem Fleischereibetrieb brachte er es schnell zu Wohlstand, lernte aber auch die Wechselfälle und Risiken des Unternehmertums kennen. Mit knapp vierzig Jahren musste er seinen Betrieb schließen. Damals hatte ihn längst die Leidenschaft für die Kunst und den Handel damit gepackt. Er begann, alte Meister zu sammeln und – mit Gewinn – wieder zu verkaufen. Vor allem auf Auktionen versuchte er sein Glück und stieg nach und nach immer tiefer in den Kunstmarkt ein. „Die Auktionshäuser waren damals schon sehr professionell. Sie haben Kataloge und weltweite PR gemacht“, erzählt Carlos Brandl auf ruhige Art. Er hält sich meist im Hintergrund und überlässt seiner temperamentvollen Frau das Reden.
Heute sind nur noch wenige Altmeister in seinem Besitz, Moderne und vor allem Zeitgenossen dominieren die exquisite Sammlung des Ehepaars. Brandls Spürnase hat ihnen aber auch hier zu einigen außergewöhnlichen Erwerbungen verholfen. Gerne erzählt Manuela Alexejew die Geschichte vom Kauf ihres traumhaft schönen Werks von Otto Piene, das heute bei ihnen über einem flachen Sideboard hängt. Es ist eines seiner „Feuerbilder“, eine quadratische Leinwand von tiefem, intensivem Rot, in der Mitte eine kreisrunde versengte Fläche, die mit dem Licht auch die Gedanken des Betrachters wie ein schwarzes Loch zu verschlucken scheint. „Gerade mal briefmarkengroß“ sei die Abbildung in dem Katalogheft des New Yorker Auktionshauses gewesen, in dem Brandl es entdeckt habe, berichtet Alexejew. Er bot mit und bekam am Telefon den sehr günstigen Zuschlag. Doch als das Werk schließlich bei ihnen in Berlin eintraf, sah es aus „wie ein schmutziges Betttuch“. Es hing labbrig in seinem Keilrahmen und war übersät mit Colaflecken. Eine Katastrophe. Doch die beiden gaben nicht auf. Sie ließen das vernachlässigte Kunstwerk restaurieren und heraus kam ein Meisterwerk. Als im Sommer 2014 die Berliner Neue Nationalgalerie den Zero-Künstler mit einer großen Retrospektive ehrte, verliehen sie ihre feuerrote Leinwand für die Ausstellung. Dass Otto Piene nur einen Tag nach der Ausstellungseröffnung in einem Taxi in Berlin starb, ist für Alexejew und Brandl nun ebenso Teil der persönlichen Geschichte ihres Bildes wie die Wiedergeburt des ungepflegten Auktionsfundes zur museumsreifen Leinwand.