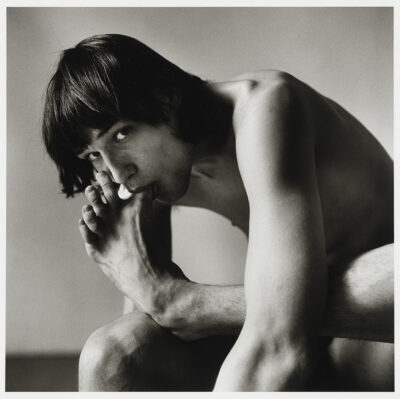Ruf der Straße
Spontan und ungestellt, den ausdrucksvollsten Moment erfassend und nah am alltäglichen Leben: Die Street Photography ist für viele der Inbegriff der Fotokunst. Sammelnden bieten sich Bilder in allen Preiskategorien
Von
02.08.2023
/
Erschienen in
WELTKUNST Nr. 214
Was bringt der beste Bürojob, wenn die Welt da draußen lockt? „Ich will raus auf die Straße, das Leben fotografieren“, sagte Joel Meyerowitz 1962 seinem Chef und quittierte seinen Posten als Artdirector. Er hatte sich anstecken lassen. Garry Winogrand, mit dem er sich angefreundet hatte, machte es vor. Rastloser Sehhunger trieb den zehn Jahre älteren Winogrand als Fotografen durch die Straßen New Yorks. „We’ll have coffee, we’ll go out, we’ll shoot“, sagte er morgens zu Meyerowitz. Und dann stürzten sich die beiden ins Gewühl, mitten in die Action, mischten sich unter die Demonstranten, möglichst weit vorn, wo auch die TV-Sender filmten, oder in den Trubel der Fifth Avenue, wo es den besten Mix aus schönen Frauen, Limousinen, Brezel-Verkäufern und Geschäftsleuten gab – und das beste Licht.
Was dabei herauskam: ein ungestelltes Foto, weder geplant noch inszeniert. Ein Konzentrat alltäglichen Lebens, das sich im öffentlichen, überwiegend urbanen Raum abspielte, spontan aufgenommen, gesteuert von der Intuition und ohne auch nur eine Zehntelsekunde zu zögern, dabei häufig mit Sinn für absurde, sonderbare Momente. Bei Winogrand, der mit der Kleinbildkamera, weitwinkliger Optik und hoher Verschlussgeschwindigkeit arbeitete, wirkt das Ergebnis fast immer wie aus der Balance gekippt. Robert Frank leistete sich Unschärfen und unerwartete Perspektiven, William Klein starke Kontraste und verschwommene Konturen. „Get close and personal“, lautete Kleins Devise. Fotografen wie er waren Regelbrecher, nicht interessiert an harmonisch komponierten Bildern, wie sie Henri Cartier-Bresson lieferte, das französische Vorbild, an dem sich Generationen von Fotografen auf beiden Seiten des Atlantiks abarbeiteten.
Der entscheidende Moment
Worum geht es beim viel benutzten Begriff der Street Photography? Ist es ein Genre, eine eigenständige Kunstform oder nur eine Wortkonstruktion, hinter der sich eine Vielzahl von Motivbereichen verbirgt, das Porträt, die Reportage oder Architekturfotografie? Die genaue Abgrenzung ist schwierig. Weegee alias Arthur Fellig etwa, bekannt für grell ausgeleuchtete Bilder von toten Gangstern und Verbrechensopfern der 1930er- und 1940er-Jahre, arbeitete freiberuflich als Berichterstatter rund um die Aktivitäten der New Yorker Polizei. Er wusste genau, wie Bilder beschaffen sein mussten, die von den Boulevardzeitungen gedruckt werden sollten.
Helen Levitt mit ihren Szenen spielender Kinder in New York wird in der einschlägigen Literatur als klassische Straßenfotografin gewürdigt, eine, die die Menschen nicht kannte, die sie aufnahm, und oft nicht bemerkt wurde. Ihr Kollege Walker Evans bezeichnete Levitts Art zu arbeiten als „Antijournalismus“. Sie war ohne Auftrag unterwegs, wollte weder Soziologin noch Dokumentaristin sein. Sie hielt Distanz.
Ein Grenzfall war auch Diane Arbus. Sind ihre Arbeiten der Fifties und Sixties nicht eher Bildnisse als Straßenfotos? Joel Meyerowitz hat erlebt, wie sie zu ihren Bildern kam: leise, geduldig und mit Empathie gewann sie das Vertrauen ihres Gegenübers. Kein Wunder, dass sie mit den schrägen Bildern des umhertigernden, blitzschnell reagierenden Winogrand nicht so viel anfangen konnte, wie Meyerowitz erzählte. Und was ist mit Ragnar Axelsson, der das Leben der Bewohner arktischer Regionen festhält? Wo er fotografiert, gibt es oft überhaupt keine Straßen. Hier ist die Natur der öffentliche Raum.

Was diese Fotografinnen und Fotografen eint: Sie waren nicht nur im entscheidenden Moment zur Stelle, sie waren wachsam und vorbereitet. „Ich zog den ganzen Tag durch die Straßen, höchst angespannt und bereit zuzuschlagen, entschlossen, das Leben „einzufangen“, es im Akt des Lebens zu konservieren. Vor allem war ich darauf aus, das ganze Wesen einer Situation, die sich gerade vor meinen Augen abspielte, in einem einzigen Foto zu ergreifen“, rekapitulierte Cartier-Bresson 1952 in seinem berühmten Essay „Der entscheidende Augenblick“.
Der hier zu betrachtende Zeitraum umfasst rund 130 Jahre. Es begann in Paris, aber ging erst so richtig los, als sich in den 1890er-Jahren Handkameras zu verbreiten begannen. Kürzere Belichtungszeiten erlaubten es, Motive in Bewegung festzuhalten. Großzügig betrachtet, lassen sich die Anfänge auch schon um 1850 ansetzen. Da traute sich Charles Nègre bereits an bevölkerte Straßenszenen und dokumentierte sogar spontan das Unglück eines gefallenen Pferdes.
Ein Sonderfall ist der im Zusammenhang mit der Street Photography oft genannte Eugène Atget, der sich um 1900 mit langem Atem durch die vom Abriss bedrohten Pariser Stadtteile fotografierte. Er war noch mit der unhandlichen Plattenkamera unterwegs, schuf damit aber höchst ungewöhnliche, fast surreal wirkende Ansichten, die auf nachfolgende Generationen von Fotografinnen und Fotografen Eindruck machten. Brassaï zum Beispiel reagierte auf Atget mit nächtlichen Paris-Aufnahmen, zu besichtigen in seinem bekannten Buch „Paris de nuit“ von 1933.

Die frühen von der Straße faszinierten Fotografen waren Flaneure wie Heinrich Zille und Arnold Genthe. Wohlhabende Amateure durchstreiften die Metropolen wie Jacques-Henri Lartigue oder Alice Austen. Der Zufall spielte ihnen die Motive vor die Linse. Susan Sontag beschrieb sie in ihrer 1977 erschienen Essaysammlung „Über Fotografie“ treffend als „eine bewaffnete Spielart des einsamen Wanderers“, der sich an „das großstädtische Inferno heranpirscht und es durchstreift – ein voyeuristischer Spaziergänger, der die Stadt als eine Landschaft wollüstiger Extreme entdeckt“.
Sammeln mit Fokus
Es gab aber auch Fotografen, die mit einer Mission und einem Plan ans Werk gingen. Der Schotte John Thomson etwa schloss sich mit dem auf sozialpolitische Themen spezialisierten Journalisten Adolphe Smith zusammen, um die schreckliche Armut inmitten der Hauptstadt aufzuzeigen. Das Ergebnis war die 37-teilige Serie „Street Life in London“, 1877/78 mit begleitenden Texten erschienen. Damit wurde dem bürgerlichen Publikum unmittelbar vor Augen geführt, was es bis dahin meist nur aus der Literatur oder oft karikierenden Illustrationen kannte.
Susan Sontag, die vernichtende Kritik an Thomson und dessen Nachfolgern übte, hatte offensichtlich nicht genau genug hingeschaut. Denn sie warf Thomsons Bildern vor, sie markierten den Beginn einer quasi-dokumentarischen Fotografie, die auf das Leben anderer herabblicke. „Street Life in London“ stelle hegemoniale Tendenzen eines „Klassentourismus“ zur Schau. Was Sontag übersah: Thomson und Smith kommunizierten auf Augenhöhe mit den fotografierten Menschen, und sie gaben ihnen in den Texten eine eigene Stimme.