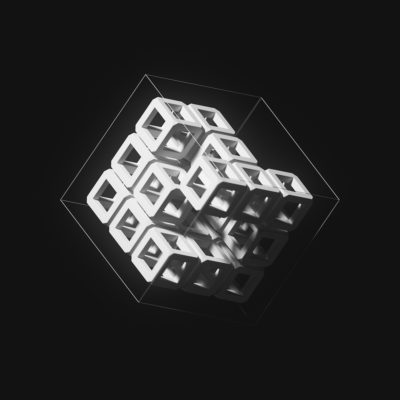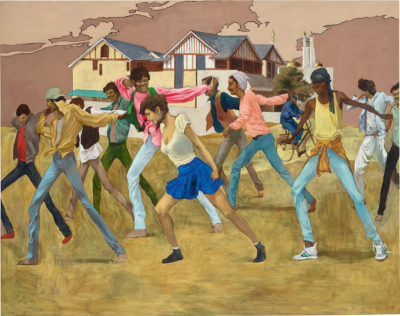„Natürlich wird mit NFT spekuliert“
Als digitale Eigentumszertifikate sind Non-Fungible Tokens, kurz NFT, gerade der große Renner am Kunstmarkt. Gehört der Kryptokunst die Zukunft?
Von
31.01.2022
/
Erschienen in
WELTKUNST Nr. 195
Wie meinen Sie das?
Banz Mittlerweile verbringt ein großer Prozentsatz der Erdbevölkerung so viel Lebenszeit in virtuellen Räumen – und damit meinen wir auch den Internetbrowser oder eine soziale Plattform –, dass das virtuelle Dasein zu einem festen Bestandteil unserer Existenz geworden ist. Wissenschaftliche Untersuchungen haben zudem gezeigt, dass für das Gehirn ein Sinneseindruck, egal, wie er zustande kommt, automatisch eine Tatsache darstellt. Wenn ich mich also lange genug in einem virtuellen Raum aufhalte, weiß ich zwar noch, dass er eine Simulation ist, doch mein Gehirn verarbeitet diese Wahrnehmung im Prinzip, als wäre sie real. Was jetzt durch NFTs passiert, ist Folgendes: Der Teil der Gesellschaft, der bereits digital unterwegs war, hat plötzlich ein Werkzeug gefunden, mit dem sich dieser Echtheitsanspruch der virtuellen Welt exemplifizieren lässt. Vorher war es nur schwer vorstellbar, dass ein virtueller Schuh den gleichen Stellenwert haben kann wie ein echter Schuh. Aber jetzt gibt es Käuferinnen und Käufer, für die ein virtueller Sneaker vielleicht sogar „realer“ ist als ein echter Sneaker. NFTs haben diesem Sachverhalt einen Namen gegeben, doch das Phänomen war schon davor „viral“.
Giulia Bowinkel Dass der digitale Turnschuh einem realen Turnschuh an beigemessener Wertigkeit in nichts nachsteht, war in der Szene schon lange eine Tatsache. Bei den NFTs handelt es sich jetzt um eine neue offizielle Richtlinie, wie man Dinge verkauft und vermarktet. Sie sind gewissermaßen der neue gemeinsame Nenner. Das allgemein akzeptierte Siegel bei einer Transaktion. Aber die Frage, was eigentlich ein digitales Artefakt ist, die wird schon sehr lange in der Szene ganz selbstverständlich diskutiert. Digitale Werke sind nur für den klassischen Kunstbetrieb noch etwas relativ Neues. Digitale Kunst wurde dort in den vergangenen Jahrzehnten nahezu komplett ignoriert. Auf keiner Messe gab es digitale Arbeiten zu sehen. Und wenn doch, musste man danach suchen.
Eisenbeis Ja, weil man damit kein Geld verdienen konnte! Das ist die ganz einfache Erklärung. Ich bin Kaufmann, und es kann mir keiner erzählen, dass der monetäre Aspekt beim Boom der NFTs nicht der Treiber war. Da haben sich viele ausgetobt, und da ist einfach Kryptogeld unterwegs, das sonst keinen anderen Platz findet. Etwas zu bezahlen signalisiert allerdings auch Anerkennung und Wertschätzung. Insofern freue ich mich, dass es jetzt für Künstlerinnen und Künstler eine Möglichkeit gibt, digitale Werke zuverlässig handelbar zu machen.
Reichert Klar sind NFTs erst im vergangenen Jahr auf Messen aufgetaucht, weil sich erst jetzt damit Geld verdienen lässt. Und die Geschwindigkeit, mit der etablierte Kunstinstitutionen und Galerien auf den Zug springen, hat natürlich auch etwas Bemühtes, etwas spät Kommendes und extrem Spekulatives. Ich finde es total interessant, dass zum Beispiel das Auktionshaus Van Ham gerade zur Uhrenfirma wird, wenn nicht gar selbst zum Künstler. Wenn Herr Eisenbeis sagt: „Wir haben eine Uhr entworfen.“ Meine erste Frage wäre, wenn ich aus der Gaming-Welt käme: In welchem Spiel kann ich die Uhr eigentlich tragen? Kann ich die benutzen, oder besitze ich die einfach nur?

Eisenbeis Das steckt natürlich noch in den Kinderschuhen. Die Frage, ob man die Uhr benutzen kann, hat auch mit Schnittstellen und der Offenheit von Programmen zu tun. Hat ein Spiel wie „Minecraft“ überhaupt ein Interesse, dass von außen Dinge hineingetragen werden, die nicht über den eigenen Shop vermarktet werden? Ich vermute, die werden ihr Universum lieber geschlossen halten wollen. Ich würde daher in eine andere Richtung denken und sagen: Es gibt immer mehr Smartwatches, auf die man digitale Entwürfe übertragen kann. Dann besitzt man ein Design, so wie man die Sonderedition einer herkömmlichen Uhr besitzen kann.
Herr Reichert hat einen interessanten Punkt angesprochen: Die mit den NFTs verbundenen Werke sind brandneu und eigens für die Auktion entstanden. Van Ham verlässt also den Sekundärmarkt und handelt auf dem Primärmarkt. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob sich dadurch Ihre Arbeit als Auktionshaus verändert.
Eisenbeis Es wäre übertrieben, von einem Paradigmenwechsel zu sprechen. Aber natürlich bewegen wir uns hier in einem Primärmarkt. Es gibt keinen großen Sekundärmarkt in diesem Bereich – erst recht, wenn wir den Anspruch verfolgen, selbst die NFTs mit unserer Partnerfirma in hoher Qualität herzustellen. Bei unseren NFTs sind auch Bilddateien in voller Größe als reprofähige Dateien auf der Blockchain abgespeichert. Das ist ein Qualitätsmerkmal, das Sie nicht hinbekommen, wenn Sie selber Ihr NFT bei Open Sea oder bei Rarible minten. Und natürlich hat das auch seinen Preis.
Reichert Ich möchte gern noch auf Giulia Bowinkels Lamento antworten, dass digitale Kunst bisher ignoriert worden sei, und dem ein bisschen widersprechen: Es gibt sicher seit den 1960er-Jahren einen Diskurs darüber. Die ganze Gründungsmythologie, aus der sich heutige Fantasien vom Metaversum speisen, stammt aus der Cyberpunk-Kultur um 1980 herum, und seit den Neunzigern hat die Medienkunst auch ihr eigenes Museum in Karlsruhe.
Das ZKM, das 1997 eröffnet wurde.
Reichert Richtig. Außerdem gab es in den Neunzigern natürlich eine lebendige Net-Art-Szene. Die hat lediglich anders funktioniert. Sie hat statt auf Eigentum auf Teilhabe gesetzt. Da gab es dann auch ein Problem, weil sich mit Net-Art letztlich kein Geld verdienen ließ. Ungefähr im Jahr 2008 kam dann gleichzeitig mit der Blockchain und Bitcoin die Post-Internet-Art in die Welt, die sich auch stark mit den Hybriden von virtuell und physisch beschäftigt hat und der immer vorgeworfen wurde, dass sie die Geschichte der Net-Art zu wenig berücksichtigen würde. Und jetzt gibt es eben das Phänomen der NFTs, wo eine wirklich sinnlose digitale Fotografie einer Rosenblüte vor schwarzem Grund von Kevin Abosch für eine Million Dollar verkauft wird, während ein extrem durchdachtes, auf Konzeptkunst basierendes NFT von Simon Denny, der die CO₂-Emissionen der Ethereum-Blockchain kritisiert, nur für einen unteren fünfstelligen Betrag den Besitzer wechselt.
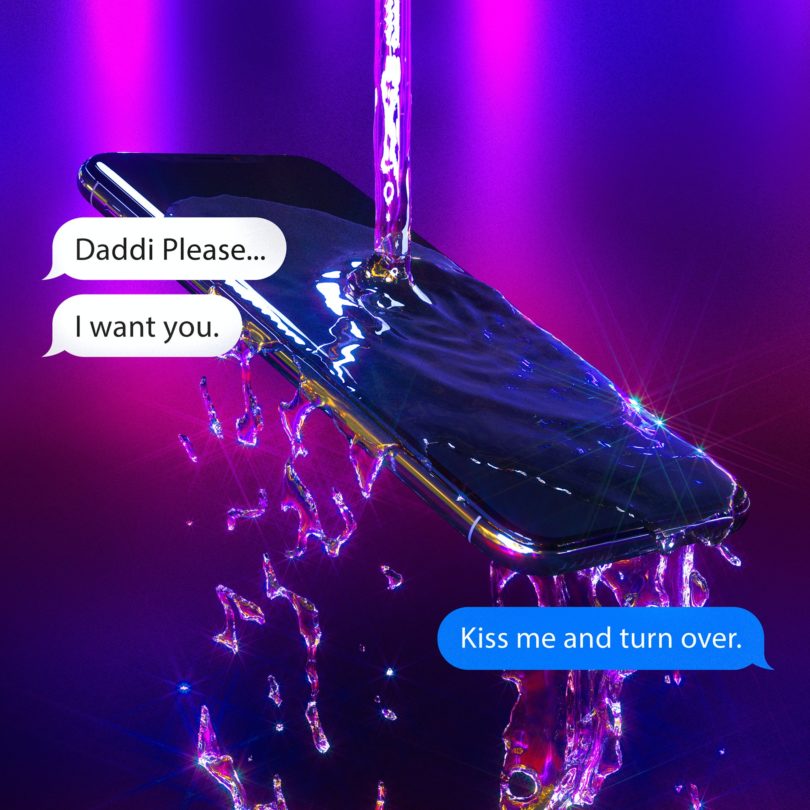
Welche NFTs finden Sie selbst aus der Sicht des Kunstkritikers besonders spannend?
Reichert Bei NFTs geht es ja letztlich um Vertragsverhältnisse zwischen Menschen. Jetzt sind plötzlich neue Vertragsverhältnisse möglich. Man kann sich via Blockchain aufeinander und auf kulturelle Güter beziehen. Und wenn wir immer darüber sprechen, dass sich jetzt damit Geld verdienen lässt, bringen wir aus unserer Welt ein Konzept von Besitz mit und legen es auf etwas, das eigentlich gar nicht aus dieser Welt kommt. Die spannendsten NFTs wurden in diesem Jahr nicht von Künstlerinnen und Künstlern gedroppt, sondern von Musikerinnen und Musikern wie zum Beispiel dem Duo Amnesia Scanner, dessen Sammelkarten Kompositionen enthielten. Alle ihre Inhaber können zusammen auf den gemeinsamen Instrumenten Musik machen. Oder Holly Herndon: Sie hat den digitalen Klon ihrer Stimme in die Hände einer dezentralen autonomen Organisation gelegt, die nun gemeinsam entscheiden kann, wie sie nicht nur Musik erschafft, sondern auch, wie sie mit den Lizenzen umgeht, die sich damit verbinden.
Also können diese neuen Beziehungen, die durch NFTs ermöglicht werden, durchaus positive Entwicklungen im Kunstbereich auslösen?
Reichert Ja. Auch das ganze Spekulieren ist plötzlich nichts mehr, was man anklagen muss. Bisher blickte man ja im Kunstmarkt mit moralischer Empörung auf die Profiteure, die Werke im Wert vertausendfacht zur Auktion bringen, während die Künstlerin oder der Künstler nichts vom Gewinn abbekommt. Durch den Eintrag auf der Blockchain haben Kunstschaffende plötzlich etwas von der Auktion. Und die Galerie, die in den Künstler investiert hat, profitiert ebenfalls. Wenn wir NFTs auf den klassischen Kunstmarkt anwenden würden, könnten wir das Problem lösen, dass man bei jeder Investition als mittelgroße Galerie fürchten muss, auf dieser Investition sitzen zu bleiben. Denn NFTs erlauben es, dass jeder, der je in ein Werk investiert hat, bei jedem weiteren Zusatzgewinn mitverdient.
Allerdings werden NFTs bisher überwiegend in Kryptowährung bezahlt. Und ich frage mich, wie akzeptiert dieses digitale Geld in der Kunstwelt überhaupt ist. Bei der Beeple-Auktion kommunizierte Christie’s zunächst, dass sich das Haus die Kommission, also seinen eigenen Anteil am Geschäft, lieber in Dollar als in Ethereum entrichten ließ.